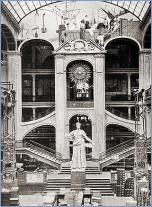
Der Lichthof im
Wertheim, Leipziger Straße |
Durch die leeren
Kolonnaden des Hauses Rosenthaler Straße 37 - 31 in Berlins Mitte,
an der Ecke Sophienstraße bläst der Wind. Hier ist das einzige der
ehemaligen Wertheim-Warenhäuser, das bis heute, wenn auch mit
verändert wieder aufgebauter Fassade, überlebt hat. Das Original des
von Alfred Messel geschaffenen Baues ist nur in der Sophienstraße
erhalten. Nicht so prächtig wie das legendäre WERTHEIM am Leipziger
Platz, weist dieses kleinere auf die Wurzeln einer der
bemerkenswertesten Berliner Karrieren der Jahrhundertwende.
Die lärmenden Straßen der Spandauer
Vorstadt und das nahe Scheunenviertel mit seinen Kellerläden, vor
denen man um Preise feilschte, wo bärtige Männer in schwarzen Hüten
auf offener Straße diskutierten, enge Gassen, in denen sich
Prostituierte und Arbeitslose herumtrieben, dies alles war dem
Stralsunder Kaufmannssohn Georg Wertheim aus seinen Lehrjahren
vertraut, als er 1885 hierher zurückkehrte, um in der Rosenthaler
Straße 27 sein erstes Berliner Geschäft für Manufaktur-, Mode- und
Damenkonfektion zu eröffnen, das hauptsächlich des geführten,
billigen Sortiments wegen gut
ging. Vorsichtig testete er andere Standorte in der Stadt, bevor er
sich zum Bau der Warenhäuser entschloß.
1892 eröffnete das erste Warenhaus
in der Leipziger Straße 110/111, ein Bau, der wegen seiner Schönheit
und Exklusivität fortan als Sehenswürdigkeit im Baedecker geführt
wurde. Derselbe Baumeister, der Architekt Alfred Messel, vollendete
nach nur neun Monaten im Dezember 1903 den Warenhaus-Bau in der
Rosenthaler Straße/ Ecke Sophienstraße.
Gleich Harrods in London und dem
Lafayette in Paris kündeten die Wertheim-Warenhäuser in Berlin vom
Beginn einer neuen Epoche. Längst vorbei die Zeiten, in denen es zu
den Pflichten einer Frau gehörte, Kleider zu nähen, Spitzen zu
klöppeln und Federbetten zu rupfen. Die moderne Großstädterin
blätterte im Wertheim-Katalog der Wintersaison 1903/1904 und
betrachtete züchtige Schwarz-Weiß- Zeichnungen von Korsett- und
Beinkleidern, Tändel- und Wirtschaftsschürzen, Ball-Fächern,
Diener-Garderoben und Putzartikeln, Flitterroben, garnierten
Damenhüten, Capes und Paletots. Ob die Arbeiterfrau aus der
Spandauer Vorstadt oder die besser situierte Dame aus dem Westen –
die Philosophie des Unternehmens Wertheim sah vor, alle Kunden
gleich zu behandeln.
Es war verboten, Personen von
höherem Rang in Gegenwart einfacherer Menschen mit ihrem Titel
anzusprechen oder bevorzugt zu bedienen. Der Erfolg der Warenhäuser
erregte bald Neid und Missgunst, besonders, nachdem der Kaiser
persönlich dem Warenhaus-Phänomen WERTHEIM einen Besuch abgestattet
hatte.
In den jüdischen Kaufhäusern
Berlins, das schrieb die rechts-nationale Presse, würde mit falschen
Maßen gearbeitet, es würden Lockwaren eingesetzt, um letztendlich
minderwertige Waren anzubieten, es herrschten schlechte
Arbeitsbedingungen und das große Angebot stelle eine sittliche
Gefährdung der Kunden dar. Die Familie Wertheim beantwortete alle
Vorwürfe mit ausgesuchter Qualität und besonderen
Sicherheitsvorkehrungen für ihre Angestellten. Bei Wertheim zu
arbeiten galt als etwas besonderes, nicht nur wegen der Größe des
Unternehmens und seines guten Rufes, sondern auch wegen des
Vertrauens, das Georg Wertheim in seine Mitarbeiter setzte.
Er verzichtete bewusst auf einen
autoritären Führungsstil. Als die Nazis zum Boykott jüdischer
Geschäfte aufriefen, glaubte der getaufte Georg Wertheim, sich mit
den neuen Machthabern arrangieren zu können. Die glitzernden
Konsumtempel in der Großstadt Berlin aber waren eines der
Hauptangriffsziele der Nazis. Sie wurden »arisiert«. Bald darauf
waren die schönsten Kaufhäuser Berlins nicht nur jüdischen
Mitarbeitern verschlossen, sondern auch jüdischen Kunden. Statt
mondäner Luxus-Puppen tummelten sich von nun an deutsche Mädels auf
grünen Alpenwiesen in den Schaufenstern.
1937 findet sich im sorgfältig
geführten Tagebuch Georg Wertheims der schlichte Eintrag: »1. Januar
– Georg Wertheims Austritt aus dem Geschäft«. Nach 32jähriger Ehe
ließ sich die Frau Georg Wertheims auf Druck der Nazis von ihm
scheiden. Georg Wertheim, der Mann, der die Berliner Einkaufswelt
kultiviert und seinen Kunden anspruchsvolle, sinnliche Erlebnisse
geschenkt hatte, der sich für ausgesuchteste Qualität einsetzte, ein
unermüdlicher Arbeiter, der, anders als seine Brüder, lange Zeit auf
eine Villa am Stadtrand verzichtet und lieber in der Nähe seines
Warenhauses gelebt hatte, um morgens pünktlich im Büro sein zu
können starb am 31. Dezember 1939 ohne Vermögen, allein, an einer
Lungenentzündung.
Die nach Amerika geflüchteten
mittellosen Neffen von Georg Wertheim, Fritz und Günther,
beantragten 1950 die Rückübertragung der 1938 unter Druck verkauften
Aktien, doch das gesamte Vermögen war auf die »arische« Ehefrau
übergegangen, die nach ihrer Scheidung von Georg Wertheim
Firmenjustitiar Lindgens geheiratet hatte. Dieser behauptete im
Verfahren 1950, der Deal hätte auch ohne die NS-Herrschaft
stattgefunden und WERTHEIM sei nichts mehr wert, weil »das gesamte
Vermögen in der Ostzone entschädigungslos enteignet« worden sei.
Es kam zu einem Vergleich, bei dem
die Neffen mit 40.000 DM abgespeist wurden. Tochter und Enkel von
Günther Wertheim haben in New York am 30. März 2000 erneut Klage
eingereicht. Ihr Anwalt glaubt, dass sie nicht nur von den Nazis,
sondern in den 50er Jahren auch vom Hertie-Konzern um ihr Vermögen
gebracht wurden, der kurz nach der Abfindung für die Wertheim-Neffen
als »historisches Schnäppchen«, wie 2001 im »Spiegel« nachzulesen,
WERTHEIM übernahm. Der heutige Wert der Rechtsnachfolgerin des
Wertheim-Besitzes Karstadt-Quelle AG wird auf mehrere Millionen Euro
geschätzt.
aus: Jüdische Korrespondenz, Nr.
2/2002 herausgegeben vom
Jüdischen Kulturverein Berlin
|