|
Beispiel Berlin:
Jüdische
Migration aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1990
Von Judith Kessler
Im
folgenden geht es zunächst um faktische Neukonstellationen bzw. Bedingungen
in Bereichen, die für die Migranten Priorität in der neuen Umgebung haben:
Arbeit und Wohnen, materielle Existenzsicherung, Konsum, familiäre und
soziale Beziehungen sowie die Aktivitäten im Umfeld der Migranten. Die
mentale Verarbeitung der neuen Situation wird Thema des zweiten Teils dieses
Kapitels sein.
4.1. Lebensbedingungen und
Alltagsbewältigung
4.1.1 Arbeit und
Beruf
Sichere Daten über die
Beschäftigungssituation der Neuzuwanderer liegen nicht vor. Die bundesweite
Studie von Steinheim-Institut/Mendelsohn-Zentrum kommt u.a. zu dem Ergebnis,
daß 40 % der Personen mit drei- oder mehrjähriger Aufenthaltsdauer einer
beruflichen Tätigkeit nachgehen und folgert, daß die "erwartete
vergleichsweise schnelle Integration" vorliege (Schoeps 1993, S.13). Die
Prozentangabe basiert allerdings auf einer Stichprobe bzw. der Aussage von
144 Befragten und scheint deutlich zu hoch gegriffen.
Nach unseren
Erkenntnissen geht derzeit höchstens ein Viertel derer, die sich länger als
drei Jahre in Berlin aufhalten, einer beruflichen Tätigkeit nach (informelle
Erwerbstätigkeiten nicht berücksichtigt); insgesamt sind etwa 80 % der nach
Berlin eingereisten sowjetischen Juden mit abgeschlossener Berufsausbildung
im juristisch arbeitsfähigen Alter noch oder wieder erwerbslos gemeldet;
dieser Wert schließt auch die Teilnahme an Deutschkursen (z.Zt. etwa 6 %)
sowie Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen (ca. 8 %) ein, die keine
Erwerbstätigkeit darstellen.
Auch wenn die Werte
für die Beschäftigungslosen und die Personen mit bezahlter Tätigkeit auf
einer Hochrechnung beruhen (53), scheint
die Fehlerquote relativ klein zu sein: der Anteil regulär Berufstätiger im
arbeitsfähigen Alter wird von der Berufsberatungsstelle der ZWST Berlin
ebenfalls mit etwa 20 % angegeben (vgl.Basse 1995); in der Stuttgarter
Untersuchung sind es sogar nur 14 %, bei jedoch durchschnittlich kürzerer
Aufenthaltsdauer als in Berlin und kleinerer Stichprobe (IRG 1994,S.23).
Die Mehrzahl der -
nach eigenen Angaben - inzwischen Erwerbstätigen arbeitet häufig lediglich
teilzeitbeschäftigt. Von den Sozialarbeitern der Jüdischen Gemeinden wird
einstimmig berichtet, daß ein Teil der Zuwanderer darüberhinaus angibt,
geringfügig beschäftigt zu sein, und zwar im Rahmen einer Einkommenshöhe,
die den Bezug der Sozialhilfe weiter gestattet. Während die Zahl der
"Umschüler" bei den bis 40jährigen am höchsten ist, überwiegen erwerbstätig
Beschäftigte in der Gruppe der 35 - 50jährigen; die über 60jährigen sind mit
wenigen Ausnahmen arbeitslos. Bei den jungen Zuwanderern stellt sich die
Situation etwas günstiger dar. In der ehemaligen UdSSR gab es kein Abitur im
deutschen Rechtssinn. Schulabgänger mit entsprechenden Leistungen konnten
nach einer 10jährigen Schulausbildung direkt an einer Hochschule studieren
(54).
Durch
Gleichsetzung mit deutschen Aussiedlern in dieser Frage ist es jüdischen
Zuwanderern erlaubt, in der Bundesrepublik nach Besuch eines vorbereitenden
sog. Studien-Collegs ein Hochschulstudium zu beginnen bzw. fortzusetzen,
wenn sie in der Sowjetunion bereits mindestens zwei Semester studiert haben.
Diese Konstellation wird wie ein Abitur anerkannt, nicht jedoch, wenn die
Jugendlichen direkt von der Schule kommen bzw. ihr Studium in der
Sowjetunion bereits abgeschlossen haben. In diesem Fall müssen sie das
deutsche Abitur nachmachen, um hier studieren zu können.
Von den 17 -
25jährigen Zuwanderern mit abgeschlossener Schulbildung und ohne
abgeschlossene Berufsausbildung waren bei der Voruntersuchung 1993 64 %
beschäftigungslos, 28 % Studienanfänger bzw. -fortsetzer (meist Musik,
Ökonomie, Zahnmedizin) und 8 % hatten eine Berufsausbildung (z.B.
Zahntechniker, Reisekauffrau) begonnen. Dieser proportionale Trend setzt
sich fort, wobei im Zeitverlauf die Zahl der beschäftigungslosen
Jugendlichen um ein Drittel abgenommen hat: Bei noch schulpflichtigen
Jugendlichen wird von den Eltern sehr häufig darauf gedrungen, daß sie das
Abitur erwerben, was zunächst einen längeren Schulbesuch bedeutet; einigen
jungen Migranten ist es ferner gelungen, einen Platz in einem
berufsvorbereitenden Lehrgang zu erhalten.
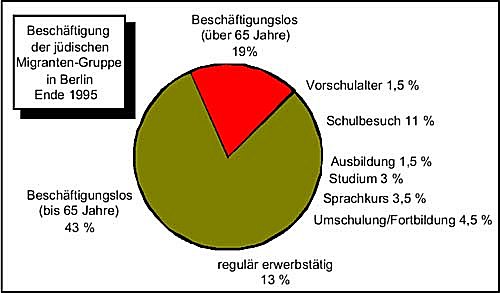
Auf die gesamte,
untersuchte Berliner Gruppe bezogen, ergibt sich derzeit für die
Beschäftigungssituation etwa nebenstehendes Bild: Über die Art der Tätigkeit
der Erwerbstätigen sind ebenfalls nur Daten von einem Teil der Zuwanderer
verfügbar. Lediglich 25 % der Berufstätigen arbeiten - nach ihren Angaben -
im eigenen, 75 % in einem fremden Beruf bzw. einer fremden Branche, in fast
allen Fällen unter ihrer Qualifikation. Eine Ursache dafür ist der hohe
Anteil der "Intelligenzia", der
Akademiker
unter den
Migranten, deren sowjetische Ausbildung hier häufig nicht anerkannt wird
oder die keine Erlaubnis zur Ausübung ihres Berufes erhalten (z.B. Lehrer,
Krankenschwestern, Ärzte) (55).
Vereinzelte
Anerkennungen sind im medizinischen Bereich über komplizierte langwierige
Verfahren erreicht worden, die mehrjährige Berufspraktika und unbezahlte
Gastarzttätigkeiten erfordern, jedoch keine Garantie für eine tatsächliche
Berufsanerkennung darstellen. Eine Praxiseröffnung setzt wiederum die
deutsche Staatsbürgerschaft voraus. Israelische Studien stellten jedoch
fest, daß es gerade die eingewanderten Lehrer, Ärzte und Wissenschaftler
sind, die eine ausgeprägte Berufsauffassung haben, ihren Beruf als Berufung
verstehen und nicht geneigt sind, ihn aufzugeben. Vielmehr würden sie sogar
bereit sein, ein Sinken ihres Lebensstandards hinzunehmen, um auf ihrem
Gebiet weiterhin tätig sein zu können (Bade 1993 S.177). Für Mediziner und
in der Forschung tätige Wissenschaftler zeigt sich dies auch in Berlin.
Selbst die geringste, schlechtbezahlteste Chance, die Berufsanerkennung
künftig doch noch zu bekommen oder wenigstens im weitesten Sinne im eigenen
Bereich arbeiten zu können, wird genutzt. So gibt es etliche Ärzte, die als
Krankenschwester/Hilfspfleger arbeiten und Wissenschaftler, die Hilfsdienste
in diversen Forschungsinstituten ausüben. Technischen Spezialisten und
Naturwissenschaftlern (z.B. Programmierer, Mathematiker, Raumfahrttechniker)
gelingt der Wiedereinstieg hingegen oft relativ gut, ebenso wie
Positionsinhabern unstandardisierter Berufe (Musiker, Maler). Für
darstellende Künstler oder Journalisten ist die fehlende Sprachkompetenz
jedoch häufig ein besonders großes Handicap. Insgesamt ist eine akademische
Ausbildung bei der Arbeitsuche selten von Vorteil. Migranten mit
Handwerks- und
Dienstleistungsberufen
haben bessere
Einstiegschancen, jedoch selten bei deutschen Firmen (außer im Baugewerbe).
Proportional mehr Zuwanderer arbeiten bei "russischen" Arbeitgebern (in
Spielhallen, Läden, Arztpraxen, Reinigungsfirmen) oder versuchen sich
selbständig zu machen, z.B. als Schuhmacher, Schneider, Gastronom (oft
Personen aus dem asiatischen Teil der UdSSR).
Hoch ist auch die Zahl
der "Umsteiger", die als frühere Ingenieure z.B. nun Handelsfirmen eröffnen.
">Business< ist für die Russen das Zauberwort. [..] Ärzte schlossen ihre
Praxen, Wissenschaftler wechselten in die boomende Im- und Exportbranche" -
schreibt DER SPIEGEL (35/1995,S.62). Auch das Statistische Landesamt Berlin
(1994) zählte die meisten beschäftigten Staatsbürger der ehemaligen
Sowjetunion im Bereich Dienstleistungen, gefolgt von den Sparten Handel und
Verarbeitendes Gewerbe. Wie die Praxis der Sozialberatung zeigt, müssen
viele dieser Kleinunternehmen jedoch nach kurzer Zeit hochverschuldet wieder
schließen, da der Verbraucherbedarf und die Verdienstmöglichkeiten
überschätzt oder notwendige Steuerzahlungen unterschätzt wurden und
häufig nur mangelhafte Kenntnisse über Management, Rechnungswesen und
hiesige Marktmechanismen bestanden.
Viele Zuwanderer haben
daneben bestimmte
Spezialausbildungen
(z.B. ein Biologe, der
auf die sibirische Botanik spezialisiert ist), unvermittelbare Berufe (z.B.
Dozent für Marxismus-Leninismus) oder Qualifikationen, die den Anforderungen
in der Bundesrepublik nicht genügen (z.B. Bautechniker) und eine Umschulung
bzw. Fortbildung dringend erfordern würden (auch wenn die Ausbildung formal
anerkannt wurde). Wie in Berlin stellen jedoch auch die westdeutschen
Gemeinden fest (vgl. IRG,1994,S.15), daß die Arbeitsämter Umschulungen und
Anpassungsqualifikationen mit der häufigen Begründung verweigern, daß eine
Qualifikation bereits vorhanden sei und somit kein Handlungsbedarf bestehe.
Andere Migranten lehnen Qualifizierungen wiederum ab, meist solche, die sie
nicht selbst ausgesucht haben, sondern die z.B. über Träger von
Fortbildungmaßnahmen angeboten werden oder sie haben sich mit ihrem
"Arbeitslosenschicksal" abgefunden. Die Motivation, durch berufliche
Qualifizierung die eigenen Arbeitsmarktchancen zu verbessern, stagniert
durch die erzwungene Untätigkeit und nicht erkennbare Zukunftsperspektiven.
Ferner fehlen Kenntnisse und Erfahrungen bei der Suche nach Arbeitsstellen
und bei Bewerbungsstrategien.
Durch die autoritären
und entmündigenden gesellschaftlichen Verhältnisse in der früheren
Sowjetunion haben sich Verhaltensweisen entwickelt, die die berufliche
Integration zusätzlich erschweren: mangelnde Flexibilität, Eigeninitiative,
individuelle Planung und Selbständigkeit (vgl. Basse 1995). Hinzu kommen die
häufigen Ablehnungen auf Arbeitsgesuche (ungeachtet auch anerkannter
Berufsabschlüsse) und Kündigungen nach der Probezeit. So sinkt mit
zunehmender Aufenthaltsdauer für viele das Sicherheitsgefühl. Offenbar recht
viele Miranten, die keinen ihrer Ausbildung entsprechenden Arbeitsplatz
finden, wechseln so zum "grauen"/"schwarzen" Markt über, vor allem um die
Situation ihrer Familie zu konsolidieren.
Aber auch mangelhafte
Sprachkenntnisse
sind (noch) Ursache
für die geringe Beschäftigungsquote. Die Zuwanderer, über die hier die Rede
ist, sind längstens seit sechs Jahren (seit 1990) in Deutschland. Nur wenige
verfügten bei ihrer Einreise über Deutsch-Kenntnisse und nur wenige waren
zuvor jemals in der Bundesrepublik oder einem anderen westlichen Land
gewesen. Die Deutsch-Kurse der Arbeitsämter (nach § 62 AFG) sind jedoch -
für jüdische Migranten und deutsche Aussiedler - von zunächt 12, dann 10 auf
inzwischen 6 Monate gekürzt worden. Neben Sprachkompetenzen zur
Alltagsbewältigung, die in dieser Zeit nur unzureichend erlernt werden
können, fehlen besonders Sprachfähigkeiten, die für den jeweiligen Beruf
wichtig wären. In Berlin wird erst allmählich damit begonnen, spezielle
Aufbaukurse für bestimmte Berufsgruppen einzurichten; in anderen
Bundesländern fehlen derartige Kurse - ebenso wie systematische Ansätze zur
Berufsintegration - noch völlig.
Die Sprachkenntnisse
(v.a. das aktive Sprechen) verschlechtern sich zudem nach Abschluß der
Deutsch-Kurse rapide, da sich die arbeitslosen Migranten fast ausschließlich
in einer russischsprachigen Umgebung aufhalten und Kontakte außerhalb der
eigenen Gruppe selten sind. Jugendliche und junge Erwachsene lernen die
Sprache hingegen oft schnell, besonders wenn sie eine realistische Chance
haben, hier zu studieren oder eine Ausbildung zu beginnen. Diese
Altersgruppen sind zudem aufnahmefähig und befinden sich zumindest einen
Teil des Tages durch den Besuch von Schulen oder Studien-Collegs in einem
deutschsprachigen Umfeld. Bei erwachsenen Migranten, d.h. bei Personen, die
etwa zwischen 25 und 60 Jahre alt sind, ist der Spracherwerb bzw. die
Motivation dazu u.a. davon abhängig, ob die Personen allein oder mit Familie
einreisen und wo sie herkommen. Ledige jüngere Männer und alleinstehende
Frauen der "Zwischengeneration" aus dem europäischen Raum fallen durch
schnelleren Spracherwerb auf als Verheiratete und Frauen mit Kindern bzw.
Personen aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion (sie leben meist noch
isolierter vom deutschsprachigen Umfeld bzw. konzentrieren sich auf die
Familie). Insgesamt nehmen ältere Personen (etwa zwischen 45 und 60 Jahren),
oft gemeinsam mit dem Ehepartner, proportional häufiger Deutsch-Kursangebote
wahr als Jüngere, die z.B. angeben, "keine Zeit dafür" oder "andere
Probleme" zu haben. Der Spracherwerb der Migranten im arbeitsfähigen Alter
korreliert relativ schwach mit dem Bildungsniveau, aber stark mit den
wahrgenommenen Chancen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. Besonders bei
Migranten aus Berufen mit hohem Sozialprestige führt die Unsicherheit
darüber, ob sie ihren Beruf jemals wieder ausüben können zu einer sinkenden
Motivation, Deutsch zu lernen (56).
Grob zusammengefaßt,
sind drei "aktive" Gruppen erkennbar, die im Zeitverlauf gleichbleibend
stark motiviert sind, Arbeit oder Beschäftigung zu finden: die erste Gruppe
beschränkt sich auf Bemühungen im selben Beruf wie in der Sowjetunion
weiterzuarbeiten (was einen Spracherwerb meist impliziert); die zweite
Gruppe ist bereit jede Arbeit anzunehmen oder umzulernen, der dritte Teil
der Aktiven (meist Männer) möchte "egal wie" materiellen Wohlstand erreichen
(pendelt z.B. zu Erwerbszwecken zwischen der alten und neuen Heimat oder
arbeitet illegal). Jüdische Zuwanderer und deutsche
Aussiedler
sind in
bezug auf ihre Arbeitsmarktsituation schwer vergleichbar, da letztere häufig
schon länger in der Bundesrepublik leben und exakte Angaben zur
Arbeitslosigkeit/Beschäftigung auch für sie nicht vorliegen. Nach
verschiedenen Quellen ist ihre Arbeitslosenquote ähnlich hoch wie bei den
jüdischen Neuzuwanderern und nimmt der Sozialhilfebezug ständig zu
(Diakonie-Korrespondenz 10/95). Trotz unterschiedlicher Bildungs- und
Berufsstruktur drängen beide Gruppen auf einen zunehmend überlasteten
Arbeitsmarkt, deckt sich bei Aussiedlern die mitgebrachte Qualifikation noch
seltener mit den nachgefragten Anforderungen (nur knapp 1/3 konnte
langfristig im alten Beruf weiterarbeiten) und sind mangelnde
Deutsch-Kenntnisse oft ebenso Ursache für Arbeitslosigkeit
(57). In größerem Maße als die jüdischen Zuwanderer der "Vierten Welle"
brachten sie jedoch gesuchte handwerkliche Berufe mit und konnten sich z.T.
recht gut etablieren; Männern aus manuellen und Gewerbeberufen gelang der
berufliche Wiedereinstieg am besten (Koller 1993). Die deutsche Minderheit
in der UdSSR war für ihre strenge Arbeitsmoral und Disziplin bekannt und
zieht auch hier eine z.B. berufsfremde Fließbandarbeit der Arbeitslosigkeit
o. zeitraubenden Umschulung vor; anders als bei den jüdischen Migranten
setzt auch kaum jemand die in der Sowjetunion begonnene Ausbildung fort
(Dietz 1990). Die aus der Ober- und Mittelschicht stammenden jüdischen
Migranten haben hingegen ein hohes und z.T. unrealistisches Anspruchsniveau
an ihre Arbeit/Ausbildung bzw. sind seltener gewillt, unterhalb ihres
Ausbildungsniveaus zu arbeiten. Auffällig ist jedoch, daß
Frauen
häufiger als
Männer (und häufiger als Aussiedler-Frauen) an Sprachkursen, Umschulungen
und Fortbildungen teilnehmen. Bei den Erwerbstätigen sind sie zwar im
eigenen Beruf seltener vertreten als Männer, jedoch in fremden Berufen bzw.
unterhalb ihrer Qualifikation öfter als diese. Gegenüber Aussiedler-Frauen,
denen ein beruflicher Wiedereinstieg besonders selten gelingt (Koller 1993),
sind sie proportional häufiger und schneller wieder erwerbstätig. Auch
Mertens bemerkt für Israel, daß sich sowjetische Migrantinnen eher beruflich
eingliedern lassen und bereiter sind, Arbeiten unter ihrem Ausbildungsniveau
anzunehmen als Männer (1993,S.170). Möglicherweise tragen ein niedrigeres
Anspruchsniveau oder höhere Toleranzschwellen dazu bei, daß sie sich dabei
zufriedener und optimistischer über ihre Arbeit äußern als Männer in
vergleichbaren Tätigkeiten. Jedoch haben auch sie das Gefühl, als Ausländer
unterbezahlt und von deutschen Kollegen nicht angenommen zu werden und
schlechtere Arbeit zugewiesen zu bekommen (siehe 4.1.4; 4.2.1).
Für Prognosen der
Beschäftigungsentwicklung der Zuwanderer ist es insgesamt noch zu früh. Die
Einwanderer der 70er Jahren hatten gezeigt (damals ohne nennenswerte
staatliche Unterstützung), daß sie sich längerfristig auf dem Arbeitsmarkt
behaupten konnten und dabei letztlich flexibler waren (sind) als andere
Migrantengruppen; d.h. die Zahl der langansässigen arbeitslosen sowjetischen
Juden ist proportional deutlich kleiner als die langansässiger Aussiedler
oder z.B. der türkischen Bevölkerung in Berlin (vgl. Infratest 1995).
Allerdings war die frühere jüdische Einwanderungsbewegung bedeutend kleiner
und "jünger", der Arbeitsmarkt weniger überlastet und es konkurrierten
weniger Personen mit anderen Ausländern sowie den nun ebenfalls verstärkt
arbeitslosen deutschen Akademikern um Arbeitsplätze
(58).
Das bislang
noch weitgehend brachliegende Bildungs- und Qualifikationspotential der
neuzugewanderten Gruppe könnte jedoch – bei entsprechender Intervention in
bezug auf Anpassungsqualifikationen und Ressourcenzugänge – auch dem
deutschen Arbeitsmarkt zugute kommen.
4.1.2 Lebensunterhalt und Konsum
Ähnlich wie zu der
Berufs- und Ausbildungssituation sind auch zu Einkommensarten und -höhen der
Neuzuwanderer lediglich Angaben zu Teilaspekten verfügbar, da Veränderungen
der Arbeits- und Einkommenssituation unvollständig erfaßt sind resp. von den
Zuwanderern häufig nicht gemeldet werden.
Ein Teil der
Kontingentflüchtlinge im arbeitsfähigen Alter besucht z.Zt. noch
Deutschkurse und bezieht Eingliederungsgeld. Personen, die den Kurs vor
weniger als einem Jahr beendet haben, erhalten Arbeitslosenhilfe, solche in
Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Ausbildung und Studium bekommen
u.U. Ausbildungsbeihilfen bzw. Lafög/Bafög. Alle anderen nicht
erwerbstätigen oder geringfügig beschäftigten Migranten mit Kontingentstatus
haben Anspruch auf Sozialhilfe, gegebenenfalls zusätzlich auf Kinder- und
Erziehungsgeld sowie Unterhaltsvorschuß. Der Lebensunterhalt der
älteren
Zuwanderer, die
auf dem Arbeitsmarkt keinerlei Chancen haben, wird ebenfalls hauptsächlich
über die Sozialhilfe abgesichert. Darüberhinaus bestehen folgende Regelungen
der Rentenversicherungsträger: Im Gegensatz zu Aussiedlern können eine Rente
nur Personen erhalten, die bis Ende 1992 im Rentenalter in das
"Beitrittsgebiet" eingereist sind und auch da bleiben (in diesem Fall gilt
das Sozialversicherungsabkommen der DDR mit der UdSSR weiter). Juden, die
sich als Deutsche verstehen - und wie z.B. die Rußlanddeutschen ursprünglich
aus Deutschland kamen - müssen, um nach dem Bundesvertriebenengesetz
(christlichen) Vertriebenen und Spätaussiedlern gleichgestellt zu werden,
ihre Zugehörigkeit zum "deutschen Sprach- und Kulturkreis" nachweisen, womit
sie einen Rentenanspruch nach dem Fremdrentengesetz erwerben. In
Einzelfällen können seit kurzem auch ehemalige Soldaten der Roten Armee, die
durch Kriegseinwirkung invalidisiert wurden, Leistungen bei der
Kriegsopferversorgung beantragen. Für Zuwanderer, die sich unter dem
Naziregime im Ghetto, KZ oder auf der Flucht befanden, gibt es je nach
Bundesland verschiedene Möglichkeiten, zusätzliche Beihilfen zu beantragen,
wie z.B. beim Hardship-Fund der Jewish Claims Conference (vgl. auch
Saathoff,G./Schlegel,S. 1993).
Über den Umweg der
Erfassung von Beiträgen zur Gemeindesteuer läßt sich sagen, daß nach Abzug
von Rentnern, Minderjährigen und Auszubildenden/Studenten etwa 2.300
Neuzuwanderer mit steuerpflichtigem Status verbleiben, von denen weniger als
ein Viertel Gemeindesteuern zahlt. Somit kann vermutet werden, daß über
Dreiviertel der Zuwanderer von geringfügigen Einkommen oder
Erwerbsersatzeinkommen/Transferleistungen leben, sofern korrekt angegeben.
Neben den im vorherigen Abschnitt genannten Gründen haben
Nebenerwerbsmöglichkeiten sowie das gebotene soziale Netz in der
Bundesrepublik sicher ihren Anteil an dieser Situation. Man kann von
Sozialhilfe leben, wenn auch nicht besonders gut. Ein Zuwanderer:
"In der
Sowjetunion mußte man nur für's tägliche Brot sorgen, alles andere übernahm
der Staat. Hier ist es umgekehrt."
(J., Ökonom, 44)
Obwohl keine
repräsentativen Angaben zur Selbstwahrnehmung des
Lebensstandards
und der
Lebensverhältnisse der Zuwanderer in der Bundesrepublik vorliegen, wird
dennoch fast einhellig von ihnen berichtet, daß sich ihr Lebensstandard und
oft auch die finanzielle Sicherheit durch die Emigration verbessert haben,
dies jedoch zulasten des gesellschaftlichen Status. Der Konsens verwundert
nicht, eingedenk der maroden und defizitären Situation in der früheren
Sowjetunion in allen Bereichen vom Wohnungsbau bis zur
Konsummittelproduktion einerseits und andererseits der u.a. hohen Anzahl von
Akademikern, die nun nicht mehr in ihrem angestammten Berufsfeld tätig sein
können. Damit korrespondierend zeigen sich die Migranten in Bereichen, die
in der UdSSR unterversorgt waren, hier am zufriedensten: Lebensmittel- und
Gesundheitsversorgung sowie Konsummöglichkeiten und am unzufriedensten in
Bereichen, mit denen sie in der Sowjetunion eher zufrieden waren: berufliche
Anerkennung, Schulsystem, Arbeitsathmosphäre ("Kollektivität") und
Sozialbeziehungen (siehe 4.1.4; 4.2).
Deutlich positiver als
in der Sowjetunion werden die
Konsummöglichkeiten
eingeschätzt. Nach
unserer Erfahrung sind besonders die jüngeren Zuwanderer ausgesprochen
"konsumfreudig". Vor allem zu Beginn des Aufenthalts führen die bisherigen
Konsumdefizite, die gewohnte Notwendigkeit schneller Kaufentscheidungen und
eines einheitlichen Preisniveaus zu "Hamsterkäufen" und Verschuldung.
Eingedenk dieser Erfahrung warnt die neue ZWST-Broschüre "Leitfaden für
jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion" ausdrücklich vor dem
Abschluß von Verträgen, Versicherungen und Ratenkäufen und weist darauf hin,
daß Konsumwaren keine Mangelwaren sind und Kaufentscheidungen in Ruhe
überdacht werden könnten (1995, S.35).
Auch wenn dies nicht
quantifiziert werden kann, fallen im täglichen beruflichen und privaten
Kontakt mit Zuwanderern einige Konsumbesonderheiten auf: Die Ausgaben für
Nahrungsmittel sind bei vielen relativ niedrig, da ein Großteil der Frauen
täglich kocht/bäckt (d.h.keine teureren Fertiggerichte kauft) und z.T.
ähnliche Zutaten wie in der alten Heimat benutzt, die vergleichsweise
preiswert sind (Mehl, Grieß, Graupen, Tee etc.). Etliche Migranten kaufen
Lebensmittel auch in Polen, in türkischen Discount-Märkten oder bringen sie
aus der GUS mit bzw. lassen sie mitbringen.
Die Ausgaben für
Kleidung scheinen zumindest kurz nach der Einreise recht hoch zu sein: die
mitgebrachte Bekleidung wird meist sehr schnell durch den Kauf neuer
Kleidung und Accessoires ausgetauscht, wobei viele dabei weiterhin
"russischem Geschmack" folgen. Dies fällt auch Zuwanderern auf, die bereits
länger hier leben:
"Ich erkenne
sie sofort. Moschino-Täschchen, Schmuck, egal ob echt oder nicht, Hauptsache
viel und kitschig. Viel Farbe, unmöglich geschminkt.
[..]
Pelze - wer trägt denn so etwas heute noch? Die hängen sich ihren ganzen
Besitz um den Hals und glauben, daß sie dann besser angesehen werden. Die
Männer sehen dafür richtig schäbig aus.."
(O., Studentin, 28)
Mag die Realität auch
etwas weniger kraß aussehen und auf junge Migrantinnen auch nicht zutreffen,
die sich sehr schnell "westeuropäisch" kleiden, scheint es in der Tat so zu
sein, daß Frauen positive Ausdrucksmöglichkeiten/Anerkennung über ihr
Äußeres suchen, während männliche Zuwanderer weniger Wert auf ihr Outfit
legen, dafür aber auf andere Statussymbole (z.B. auffällige Autos). Daneben
scheint der Kauf technischer Geräte für sie wichtiger zu sein. Waren sie
bereits in der UdSSR aufgrund fehlender Dienstleistungsstrukturen auf
handwerkliche Fähigkeiten angewiesen, so verdienen sich viele mit diesem
Können und den dazugehörigen Arbeitsmitteln (z.B. Bohrmaschinen) hier etwas
dazu bzw. nutzen es im eigenen Haushalt. Kühlschrank und Waschmaschine haben
- nach dem Auszug aus dem Wohnheim - ebenfalls hohe Priorität, rangieren
jedoch (zeitlich) hinter der Anschaffung von Telefon (in Westberlin verfügen
98 % der Zuwanderer-Haushalte über ein Telefon) und Fernsehgerät (mit
"Satellitenschüssel" zum Empfang russischsprachiger TV-Programme). Aufgrund
von Sprachproblemen, Isolation oder erzwungener Untätigkeit beschränken sich
soziale Kontakte meist auf das russischsprachige Umfeld und/oder auf den
häuslichen Bereich und werden u.a. durch Fernsehen und Telefonate mit der
Heimat kompensiert. Daneben verfügen etliche Privat-Haushalte über
Anrufbeantworter und Fax-Geräte, die auch für geschäftliche Kommunikation
genutzt werden.
Wenn eine Wohnung
gefunden und eingerichtet worden ist, werden verfügbare Einkommen häufig für
Reisen - hauptsächlich in die Ex-UdSSR und nach Israel - eingesetzt. Die
Kosten, die hierbei durch die Unterbringung bei Verwandten und Bekannten
gespart werden, werden durch (von letzteren auch erwartete) Geschenke und
Zuwendungen allerdings wieder aufgehoben. Einige - meist ältere kulturell
interessierte - Migranten unternehmen auch (Billig-)Bus-Reisen durch Europa.
Von Personen, die
ausschließlich auf die Sozialhilfe oder geringe Einkommen angewiesen sind,
wird jedoch häufig erwähnt, daß sie sich über den täglichen Bedarf
hinausgehende Ausgaben nicht leisten können. Im besonderen betrifft dies
Rentner und kinderreiche Familien:
"In Moskau sind
wir oft ins Theater und ins Konzert gegangen. Jetzt geht das nicht mehr. Wir
wollten so gern zu Barenboim, aber 100 Mark für die Karten können wir nicht
bezahlen. Wir gehen eigentlich nur zu den Veranstaltungen in der Gemeinde,
da ist es billig oder wir bekommen Ermäßigung."
(F., Rentnerin, 63)
"Ich wünschte,
wir könnten alle mal zusammen wegfahren, Urlaub machen. Ich bin noch nie aus
Berlin rausgekommen und mein Mann auch nicht. Die Kinder müssen immer
einzeln ins Ferienlager, für alle reicht es nicht."
(T., Geologin, 35, 3
Kinder)
An den
Konsumgewohnheiten der Umgebungsgesellschaft orientiert, wird sich jedoch
bei der Masse der Migranten die Tendenz zu einem erhöhten Konsum vermutlich
fortsetzen, wobei sich die Schere zwischen den weiterhin von Sozialhilfe
oder Kleinstverdiensten abhängigen Zuwanderern und denjenigen weiter öffnen
wird, die sich hier beruflich etablieren können oder aber andere
Einkommensquellen zu nutzen verstehen. Daß diese Entwicklung bereits
begonnen hat, bemerkt auch die Stuttgarter Studie und stellt fest: "Es
entwickelt sich ein privater Arbeitsmarkt mit der alten Heimat. Gebrauchte
Autos, Fernseher, Videorecorder, Lebensmittel u.ä. werden in privaten Reisen
in die Heimat mitgenommen und verkauft. Die Erlöse sind noch sporadisch und
bescheiden [..], sie verweisen aber auf eine mögliche 'Perspektive' in der
Zukunft: einen nicht zu kontrollierenden Graumarkt am Rande der legalen
Gesellschaft" (IRG 1994,S.25). Die zunächst schlechten gesellschaftlichen
Chancen für die Einwanderer, ihre zweckrationale Orientierung und ein
beschleunigter Lebensrhythmus tun ihr übriges zu derartigen Unternehmungen.
Dabei entstehen unvermeidlich Konflikte, wenn Zuwanderer ihre eingeübten
"Überlebens-techniken" anwenden, die aus einem System stammen, in dem
informelle "Umverteilungen" nach wie vor selbstverständlich sind, man mit
Geld buchstäblich jede Entscheidung revidieren und jede "Ware" erhalten
kann.
Es sind eher jüngere
Leute, die an der Konsumgesellschaft teilhaben wollen und anfällig sind für
die Verlockungen, die sich daraus ergeben, daß sie sich relativ frei
zwischen den Ländern bewegen können, auch die abziehenden sowjetischen
Streitkräfte und Vertragsarbeiter gerade in Berlin noch schnell das "große
Geschäft" machen wollten, die Situation in den ehemaligen Ostblockländern
chaotisch ist, es korrupte Grenzbeamte gibt und Warennachfragen aller Art
dort und hier bestehen. In Extremfällen gehen diese Konflikte bis in den
illegalen oder kriminellen Bereich (z.B. in Form von "Schiebergeschäften")
(59).
Ohne solche Tendenzen
unterschätzen zu wollen, nutzt der absolut überwiegende Teil der Migranten
die Möglichkeiten der neuen Umgebung jedoch legal und sind Generalisierungen
über eine "moralische Bedenkenlosigkeit", wie sie
den
jüdischen Zuwanderern
in einer Berliner Studie bescheinigt wird, ebenso wie die dort vorgenommene
(einzige) Kategorisierung in "Gesetzesbrecher" und "immer mehr unter ihren
Einfluß geratende Gesetzesbeachter" (Freinkman 1992, u.a. S.30) falsch und
gefährlich (60).
4.1.3 Räumliche Mobilität und
Wohnsituation
Soziale
Differenzierung führt nach Friedrichs zu räumlicher Ungleichheit , wobei der
wichtigste Prozeß, der soziale und räumliche Ungleichheit verbinde, die
Mobilität sei (in Bertels 1991, S.16). Das "biographische Kapital" der
Migranten ließ eine gewisse vertikale und horizontale Mobilität auch nach
ihrer Einreise in die Bundesrepublik vermuten. Die Lage im Arbeitsbereich -
wie die Erfahrung mit ausländischen Migranten im allgemeinen - zeigte
jedoch, daß die Zuwanderer in ihrer sozialen Mobilität (noch) relativ
gehemmt sind bzw. gehemmt werden. Andererseits kann ihre räumliche Mobilität
dazu beitragen, Disparitäten und Defizite auszugleichen. Den Ort (die Stadt,
die Wohnung) zu finden, an dem sie sich wohlfühlen und wo ihre beruflichen
und gesellschaftlichen Chancen am größten sind, ist zudem meist der erste
Schritt vor der eigentlichen Suche nach einer Arbeit.
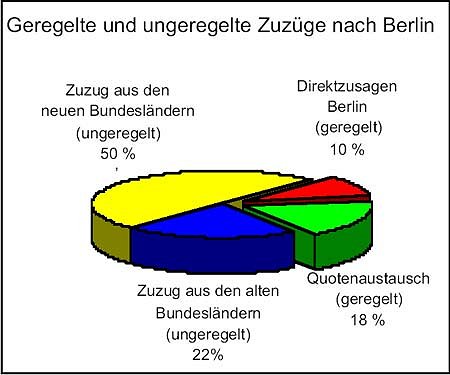
Berlin hat für
Migranten eine starke Anziehungskraft. Einem großen Teil der Zuwanderer, die
nach Inkrafttreten der Kontingentflüchtlingsregelung im Rahmen dieses
Verfahrens in einen anderen Ort der Bundesrepublik eingereist sind, ist es
gelungen, seinen Wohnsitz nach Berlin zu verlegen und das sog. "geregelte"
Verfahren, das ihren Wohnsitz festlegt, zu umgehen
(61).
Die Auszählung einer
Stichprobe (Juni 1994 bis Juni 1995) neu registrierter Mitglieder der
Berliner Jüdischen Gemeinde zeigt, daß von 500 Personen mit Kontingentstatus
359 aus anderen Bundesländern "ungeregelt" nach Berlin gekommen waren
(62).
Aus der Graphik
wird ersichtlich, daß die Fluktuation aus den neuen Bundesländern dabei
besonders stark ist (63).
2/3 aller in der
Berliner Gemeinde registrierten ungeregelten Zuzüge aus der ehemaligen DDR
kommen aus dem angrenzenden Land Brandenburg. (Nach Angaben des Landkreises
Barnim z.B. hatten allein im 1.Halbjahr 1995 mehr als über 150 Personen das
Aufnahmeheim Ahrensfelde in Richtung Berlin verlassen.) Aus Sicht der
Zuwanderer macht die bestehende Verteilungspolitik keinerlei Sinn. Besonders
im Süden der früheren DDR (aus dem die Fluktuation insgesamt auch am
stärksten ist - siehe 5.1) werden sie in Dörfern und Kleinstädten
untergebracht, in denen es an Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Wohnungen,
sozialen Kontakten und Hilfseinrichtungen mangelt und wo - so die Berichte
Betroffener - Übergriffe auf Wohnheime und Personen konzentriert sind. Zudem
sind sie das Leben in der Großstadt gewöhnt, haben Verwandte u.a. in Berlin
und einen Wohnberechtigungsschein, der paradoxerweise für die gesamte
Bundesrepublik gilt. So ist das Ziel der meisten, trotz aller Hürden in
Städte und Bundesländer mit günstigeren Bedingungen umzuziehen:
"Wir haben eine
Odyssee hinter uns. Vom ersten Tag an wollten wir nach Berlin. Die Zusage
haben wir aber für Sachsen-Anhalt bekommen. Wir waren erst in einem Wohnheim
auf dem Land, dann wurden wir umgesiedelt. Das zweite Wohnheim wurde
geschlossen und wir haben 20 km entfernt eine Wohnung auf dem Dorf bekommen.
Das gehörte schon zu Niedersachsen. Die Leute waren sehr nett, eine hat
sogar geweint, als wir weggezogen sind. Aber was sollten wir da. 140 km bis
Hannover, da war die nächste
[jüdische]
Gemeinde, keine
Arbeit, keine Kultur, kein Theater. Wir sind doch aus Leningrad. Die
Bekannten haben am meisten gefehlt. Wir hatten doch kaum Kontakte. Nach drei
Jahren haben wir es endlich geschafft, nach Berlin. Ich hab schon geglaubt,
ich werde sterben in diesem Dorf. Arbeit werden wir wohl nicht mehr finden
in unserem Alter, aber wenigstens sind alle Freunde in der Nähe."
(K.,
Krankenschwester, 50)
Wie diesem Ehepaar ist
es vielen anderen gelungen, nach Berlin umzuziehen, wobei nur teilweise
bekannt ist, auf welchem Weg, da es immer schwieriger wird, die
Wohnsitzbeschränkungen streichen zu lassen, Wohnungen am neuen Wohnort zu
finden, und Sozialämter, die bereit sind, die Kosten zu tragen
(64).
Schnelligkeit,
Ausdauer, Hartnäckigkeit, gut funktionierende Informationskanäle gehören mit
Gewißheit dazu wie auch die Mithilfe von Verwandten/Freunden, ein gewisser
"Ideenreichtum" und einige Umwege (65).
Die Zahl der
Wegzüge
aus Berlin
ist hingegen bisher außerordentlich gering und betrifft fast nur jüngere
Menschen. Von den Pendlern abgesehen, sind seit 1990 unter 1 % der
Neuzuwanderer zurück in die frühere Sowjetunion gegangen, ca. 1 % in andere
Staaten (USA, Israel) und etwa 2 % in andere Bundesländer - dies
ausschließlich berufsbedingt, d.h. wenn ein Familienmitglied Arbeit in einem
anderen Ort gefunden hat. Berlin hat so fast ausschließlich
Wanderungsgewinne zu verzeichnen.
Ebenso wie die
Migranten, die über "Umwege" nach Berlin gekommen sind, müssen die direkt
nach Berlin eingereisten Personen Wohnungen hier finden, denn auch sie
werden i.d.R. zunächst in ein Übergangswohnheim eingewiesen. Durch die
Registrierung des Auszugs aus dem Wohnheim in eine Wohnung läßt sich die
Aufenthaltsdauer
der Zuwanderer in
Übergangsheimen feststellen. Das Diagramm zeigt, daß das Gros der Zuwanderer
(41 %) 6-12 Monate in einem Wohnheim verbracht hat, 20 % sogar weniger.
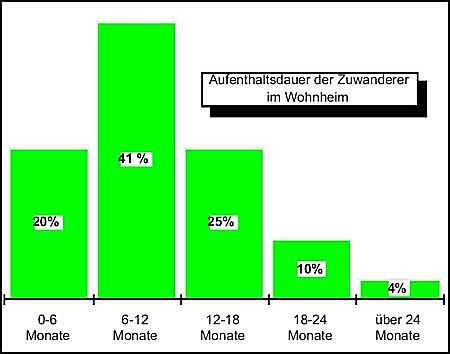
Meist handelt es sich
dabei um 1- bzw. 2-Personen-Haushalte. 39 % aller wohnten länger als ein
Jahr im Heim, davon aber nur 4 % über zwei Jahre. Die Gruppe der lange im
Heim Wohnenden setzt sich wegen fehlender bzw. nicht bezahlbarer großer
Wohnungen hauptsächlich aus Familien mit vier und mehr Personen zusammen.
Ein Zuwanderer:
"Ich habe 170
Bewerbungen geschickt. Entweder haben sie gar nicht reagiert oder abgelehnt.
Ich habe es durch Makler versucht. Aber die deutschen Makler wollen keine
Ausländer. Sie haben mich erst gar nicht angehört und die russischen nehmen
15 bis 20.000 Mark für eine 3- oder 4-Zimmerwohnung. Das Geld habe ich
nicht. Wir wohnen zu viert in einem Zimmer. Seit anderthalb Jahren. Ich weiß
nicht mehr, was ich noch machen soll. Am liebsten würde ich zurückgehen,
aber da haben wir keine Wohnung mehr."
(A., 43)
Von Problemen mit der
Wohnraumbeschaffung für große Familien berichtet auch die Stuttgarter
Untersuchung, zugleich ist die Verweildauer im Wohnheim dort im Durchschnitt
etwas länger (IRG 1994, S.19f). Neben größeren Familien sind es meist
alleinstehende Männern zwischen 40 und 60 Jahren, die längere Zeit im
Wohnheim verbringen (oft bemühen sich letztere erst intensiv um eine
Wohnung, wenn fast alle russischsprachigen Mitbewohner aus dem Wohnheim
ausgezogen sind, denn so lange ist das Wohnheim ein Mikrokosmos "russischen"
Lebens; darüberhinaus muß sich der Einzelne nicht um das Bezahlen von
Strom-Rechnungen kümmern, keine Möbel und Einrichtungsgegenstände kaufen
usw.).
Im übrigen hat sich
das Auszugstempo aus den Wohnheimen seit Beginn der Einwanderungswelle
beschleunigt. Bei der Voruntersuchung 1993 waren es noch 70 %, die länger
als ein Jahr im Heim gewohnt hatten, davon 15 % über 2 Jahre. Zum einen war
die Zuzugswelle anfangs viel kompakter (d.h. es kamen bedeutend mehr
Zuwanderer gleichzeitig), zum anderen haben die Migranten inzwischen mehr
Erfahrungen und Beziehungen auf dem Wohnungsmarkt und sind in der Lage,
nachziehenden Verwandten und Bekannten bei der Wohnungsbeschaffung zu
helfen. Für die zuletzt (1995) Eingereisten beginnt sich die Situation
jedoch allmählich wieder zu verschlechtern, da sich die Sozialämter zu
weigern beginnen, die sprunghaft gestiegenen Mieten des Berliner
Wohnungsmarkts, auch für Sozialwohnungen, zu übernehmen
(66).
Insgesamt ziehen die
Zuwanderer doch inzwischen im Schnitt recht schnell aus dem Wohnheim aus.
Sie haben keine gute, aber insgesamt eine bessere Ausgangsposition auf dem
Wohnungsmarkt als andere Migranten. Im Vergleich wieder zu den
Spätaussiedlern, deren Verweildauer in Wohnheimen im Schnitt zwischen 2 und
4 Jahren liegt (Diakonie-Korrespondenz 10/1995), haben sie vor allem weniger
Kinder und reisen weniger häufig als diese in ganzen Familienverbänden ein,
die dann auch meist geschlossen leben bleiben wollen (Bade/Troen 1995,S.79).
Angemerkt sei jedoch
nochmals, daß die Wohnsituation auch der jüdischen Zuwanderer in anderen
Bundesländern (insbesondere in den neuen Ländern) gänzlich anders aussieht.
Die Zuwanderer leben meist massiert in kleinen Ortschaften, die nicht einmal
den eigenen Wohnungsbedarf annähernd decken können. Die Entfernung zu
größeren Städten bzw. die schlechte Anbindung führt zudem dazu, daß
Informationsdefizite bestehen und Wohnungsbewerbungen lediglich schriftlich
abgegeben werden können. Daß wiederholte, persönliche Vorsprachen jedoch
fast eine Bedingung für den Erhalt einer Wohnung sind, zeigte sich bei den
Berliner Migranten.
Der Auszug aus dem
Übergangsheim bedeutet jedoch noch nicht unbedingt eine zufriedenstellende
Veränderung der Wohnsituation. So wie die residentielle Mobilität der
Zuwanderer zwischen den Städten der Bundesrepublik hoch ist, zieht auch ein
Teil innerhalb Berlins mehrfach um, um sich weiter zu "verbessern". Die
folgende Graphik erfaßt die
Umzüge
der Migranten im
Zeitraum 1.1.1990 bis 31.10.1995, die sich aus dem Eintrag im Datenfeld
"Umzüge nach der Einreise" ergeben (67).
Sie kann
lediglich einen Trend zeigen, da Personen mit kürzerer Aufenthaltsdauer
nicht getrennt von denen erfaßt sind, die bereits länger (längstens seit
1990) in der Bundesrepublik leben. Deutlich wird zumindest, daß über die
Hälfte der Zuwanderer nach ihrem Auszug aus dem Heim bzw. nach Bezug der
ersten eigenen Wohnung bereits noch einmal oder sogar mehrmals umgezogen ist
(68).
Auch wenn dies nicht
näher quantifiziert werden kann, sind häufige Umzüge eher ein Merkmal der
Zuwanderer der Jahre 1990/1991, die mit den Strukturen des Wohnungsmarktes
selten gut vertraut waren und kaum soziale Netzwerke zur Verfügung hatten
und zunächst meist jedes, auch schlechte Wohnungsangebot annahmen, um dem
Wohnheim zu entfliehen (69).
Beinahe "klassische"
Wohnkarrieren sind der Umzug vom Ostberliner Wohnheim in eine Ostberliner
Wohnung und danach in eine Westberliner Wohnung bzw. der Wechsel aus einem
Wohnheim anderer Bundesländer in ein Untermietsverhältnis in Berlin und dann
in die eigene Wohnung.
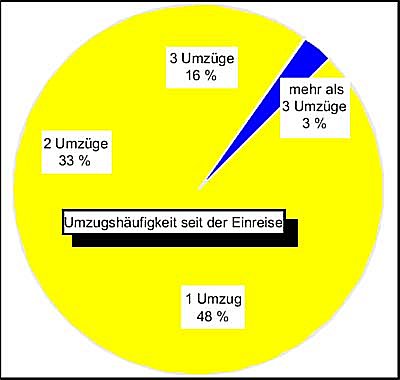
Gründe
für einen
wiederholten Umzug, wenn sie genannt wurden, waren: Entfernung zu
Verwandten, Nachzug von Verwandten, Mietpreiserhöhung, Ofenheizung,
fehlender Aufzug, Heirat, Geburt eines Kindes, Trennung und Auszug eines
Familienmitgliedes, Probleme mit Haushaltsangehörigen, vor allem aber der
Zustand und die Lage der Wohnung. Der letztgenannte Punkt betrifft besonders
Zuwanderer, die zuvor im Ostteil der Stadt wohnten. Von den 1991 über 1.200
dort lebenden sowjetischen Juden mit ihren Familien, ist über die Hälfte in
den Westteil der Stadt gezogen. Einen Umzug in umgekehrter Richtung haben
lediglich 1% der Zuwanderer gemeldet, von denen die Hälfte später jedoch
wieder nach Westberlin zurückgezogen ist. Auf der Grundlage von 3.500 auf
die Berliner Stadtbezirke zuordbaren Adressen ergibt sich somit folgende
Verteilung: Am 31.12.1995 wohnten 2.728 der neuen Gemeindemitglieder im
Westteil der Stadt und 772 im Ostteil. Neben mangelhaften
Wohnungsaustattungen, fehlenden Telefonen oder Infrastrukturmerkmalen wird
von sowjetischen Zuwanderern häufig eine vorgefaßte Abneigung gegen den
Ostteil der Stadt geäußert, der häufig mit "DDR" oder "wie in der
Sowjetunion" gleichgesetzt und negativ bewertet wird.
Einen - allerdings
sehr groben - Aufschluß über die
Wohnqualität
gibt die
Verteilung der Zuwanderer auf die einzelnen Berliner Stadtbezirke. Die
folgenden zwei Abbildungen zeigen den derzeitigen Anteil der Migranten in
den einzelnen Bezirken - zunächst getrennt nach Ost- und Westteil der Stadt:
Auf Gesamtberlin
bezogen sieht die Verteilung der Zuwanderer auf die Bezirke wie folgt aus:
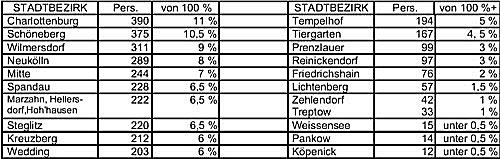
In der Presse ist -
wie schon einmal in den 20er Jahren - die Rede vom Westberliner Bezirk
Charlottenburg als "Charlottengrad" (DER SPIEGEL 35/1995), dem
Hauptansiedelungsort der "Russen" in Berlin. In der Tat hat dieser Bezirk
den stärksten Anteil an neuzugewanderten sowjetischen Juden aufzuweisen,
gefolgt von Schöneberg. Große Teile beider Bezirke zählen, ebenso wie die
stark von Zuwanderern bewohnten Bezirke Wilmersdorf, Steglitz und Spandau,
zu den mittleren bis guten Wohngegenden. Wohngebiete des gehobenen
Mittelstandes, in denen jedoch relativ wenige Zuwanderer leben, wären in
Westberlin z.B. Zehlendorf, in Ostberlin Treptow, Pankow und Köpenick. Die
Bezirke mit der höchsten Konzentration an Ausländern in Berlin sind
Kreuzberg (33 %), Neukölln (19 %) und Wedding (27 %); hier wohnen zusammen
aber nur 20 % aller sowjetischen Juden. 6 % der Migranten haben Wohnungen in
Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf, den ehemaligen Stadtrandbezirken,
in denen zur DDR-Zeit weitläufige Plattenbausiedlungen entstanden
(70).
Anders als in
Westberlin, wo sich die Zuwanderer auf das gesamte (Kern-)Stadtgebiet
verteilen, leben sie im Ostberlin entweder in diesen Neubaugebieten oder im
östlichen Stadtzentrum – in Mitte und Prenzlauer Berg. Beide Bezirke waren
schon zu DDR-Zeiten außerordentlich gemischte Wohngebiete mit einem hohen
Anteil an Arbeitern, Künstlern und "Aussteigern" sowie einem besonderen
Stellenwert von Nachbarschaft und Solidarisierung. Möglicherweise ist das
höhere Toleranzpotential ein Grund dafür, daß sich nach der Vereinigung hier
nicht nur sowjetische Juden, sondern Vertreter diverser Ethnien und
Interessen ansiedel(te)n. Während die jüdischen Migranten aus den
Neubaugebieten mit ihrem sozialen Konfliktpotential wieder abwandern,
verändert sich das Stadtbild im östlichen Zentrum (besonders in Mitte) durch
ihre Anwesenheit deutlich, in Form von Bistros, Galerien oder Läden.
Inwieweit der für den Osten ungewohnt hohe Ausländeranteil, die soziale
Polarisierung der Bevölkerung, die geplante Ansiedlung von Einrichtungen der
Bundesregierung und die Aufwertung des östlichen Stadtzentrums durch den Bau
von Geschäftsstraßen diese Situation wieder verändern wird, bleibt
abzuwarten. Nach der jeweiligen örtlichen Lage und unter Hinzuziehung des
Berliner Mietspiegels ergibt sich grob etwa folgendes Bild (Abb. nächste
Seite), das den jeweiligen Wohnungszustand und die Belegung der Wohnung
allerdings nicht berücksichtigt (siehe 4.1.4). Fast 2/3 der Zuwanderer ist
es gelungen, Wohnungen in relativ beliebten Wohngegenden zu finden. Wie oben
ersichtlich, war dazu häufig ein wiederholter Umzug notwendig, der meist
ebenfalls innerhalb recht kurzer Zeit bewerkstelligt wurde. Für den Westteil
der Stadt kann davon ausgegangen werden, daß kaum jemand in
Substandard-Wohnungen lebt (unter der übrigen ausländischen Bevölkerung
leben 17 % ohne Bad, WC oder Sammelheizung; vgl. Infratest 1995). Die nach
der großen "Welle" 1990/1991 gekommenen Migranten ziehen es auch vor, länger
in Provisorien zu leben,als Wohnungen in schlechtem Zustand oder schlechter
Lage zu beziehen; besonders Ältere äußern nun häufiger den Wunsch, die
Wohnung solle "für immer reichen"
(71).
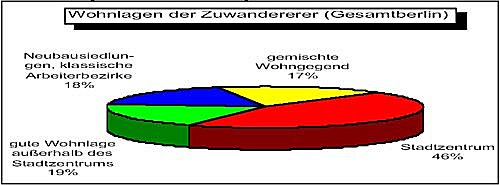
Über die
Techniken
der
Wohnungsbeschaffung ist (besonders in bezug auf Mehrfachumzüge) wenig
bekannt. Ihre erste Wohnung erhielten etwa 20 % der Zuwanderer von der
Jüdischen Gemeinde bzw. über deren Verrmittlung. Nach eigenen Angaben
bezogen ca. 30 % die erste Wohnung durch direkte eigene Bewerbungen bei
Wohnungsgesellschaften, 5 % über Annoncen und 35 % durch Bekannte, Verwandte
und Makler. Unter 10 % der Wohnungen wurden vom Wohnungsamt oder der
Abteilung für Seniorenwohnungen angeboten. Für den Erstumzug war i.d.R. ein
Wohnberechtigungsschein vorhanden. Der Bezug von Sozialhilfe ist für die
Wohnungssuche zumindest bei gemeinnützigen Unternehmen kein Hindernis, u.a.
weil die Mietzahlung relativ garantiert ist. So waren es auch meist
Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus, die nach dem Heimaufenthalt bezogen
wurden. Sie gelten unter den Zuwanderern zudem als kündigungssicher, anders
als Wohnungen privater Träger, denen Willkür unterstellt wird. Die
geronnenen Erfahrungen der Migranten in Bezug auf die bisherige
sozial-räumliche Umwelt
zeigen sich besonders
in ihren Wohnpräferenzen. Für Einheimische erstaunlich, ziehen die meisten
Zuwanderer innerstädtische Ballungsgebiete, Neubauwohnungen etc. begrünten
ruhigen Stadtrandgebieten oder den meist großzügig geschnittenen, hohen
Berliner Altbauwohnungen vor (die nach ihrer Meinung u.a. eher desolat
sind). Anders auch als die eher ländlich geprägten Aussiedler, die - so
berichten Studien einhellig - großen Wert auf das "eigene Häuschen" legen
(was in Berlin ohnehin kaum realisierbar wäre), bevorzugen die jüdischen
Migranten zentrale Orte und Hauptstraßen. Auch für Israel bemerkt Mertens
(1993,S.165), daß Wohnungen in "Prestige-Vororten" von Großstädten abgelehnt
werden, so als wären die Zuwanderer damit wie in der Sowjetunion von der
Versorgung abgeschnitten. Neben der vermeintlich nicht vorhandenen
Infrastruktur mag eine Rolle spielen, daß der neue Ortsbezug zunächst nicht
an vertraute Bauten und Plätze gebunden ist, aber an die Nähe von Personen
und Institutionen. Es verbinden sich keine "Gefühle" mit einem bestimmten
Kiez, sondern es wird, besonders von Älteren, rational nach einer
Überschaubarkeit des (auch räumlichen) Lebensumfeldes entschieden: Kurze
Wege zum Sozialamt, die U-Bahn in unmittelbarer Nähe, die Tochter in der
Nebenstraße usw. vermitteln eine gewisse Sicherheit. Zudem beschränkt sich
ihr sozialer und räumlicher Aktionsradius sehr häufig auf die Achsen
Supermarkt – Sozialbehörde – Arzt – Wohnung der Kinder (wenn vorhanden).
Dabei entstehen freilich neue Raumbezüge, die sich bei älteren Zuwandern
vorzugsweise an markanten räumlichen Punkten orientieren, u.a.weil viele
weder deutsch sprechen noch lateinische Buchstaben lesen können. Die Frage
"Wo wohnen sie?" wird sehr häufig ähnlich beantwortet, wie von der
70jährigen Soja:
"Wie die Straße
heißt, kann ich mir nicht merken. Ich erkläre es, dann wissen Sie schon: Ich
muß mit der grünen Linie
[U-Bahn]
fahren, bis zu
der Station, wo der Blumenladen auf dem Bahnsteig steht. Dann gehe ich an
dem großen Turm vorbei, dann an dem roten Haus um die Ecke und bei der
Tankstelle links..".
Einige Zusammenhänge
von
Mobilität und Sozialstruktur,
die oben (3.Kapitel) nicht nachweisbar waren, da u.a. Daten über eine
geeignete seßhafte Vergleichsgruppe fehlten, zeigen sich bei Umzügen
innerhalb der BRD bzw. Berlins: 1- bis 3-Personen-Haushalte wandern häufiger
als jene mit mehr Mitgliedern, deren Immobilität oft durch den Mangel an
großen Wohnungen diktiert wird. Migranten aus der europäischen UdSSR und
Großstädten sind mobiler als jene aus dem asiatischen Teil (die gleichzeitig
mehr Kinder haben) und aus weniger großen Städten. Eine Korrespondenz der
Umzugshäufigkeit mit dem Beruf ist kaum erkennbar – Personen aller
Berufsgruppen zeigen sich mobil. Allerdings ziehen Erwerbstätige bis jetzt
proportional seltener um als Sozialhilfeempfänger (u.U. weil die mehr Zeit
haben, sich mit dem Wohnungsmarkt zu befassen). Ein Zusammenhang zwischen
Mobilität und Alter ist ebenfalls kaum erkennbar, es beteiligen sich
Migranten aller Altersstufen an den Umzügen. Bei alten Menschen spielt
jedoch der Gesundheitszustand eine wesentliche Rolle; behinderte Ältere
"sitzen" besonders lange im Wohnheim und können ihre Situation häufig nur
durch massive Fremdintervention ändern. In der Kombination mit dem
Geschlecht sind es geringfügig weniger jüngere Frauen als jüngere Männer und
ältere Frauen als ältere Männer, die wiederholt umziehen. Lediglich in der
Verbindung Alter – Familienzyklusereignis zeigt sich ein enger Zusammenhang
bei lokalen Umzügen: mit der Veränderung des Raumbedarfs durch Heirat,
Geburt oder Scheidung wurde häufiger die Wohnung gewechselt.
Der Zusammenhang mit
der Stärke des Bezugs zur jüdischen Kultur/Religion ist ebenfalls schwach.
Bei interregionalen Umzugswünschen wird häufig die Nichtexistenz einer
Jüdischen Gemeinde/ am bisherigen Wohnort moniert (i.d.R., wenn die
Betreffenden sich bei der Gemeinde als wohnungssuchend vorstellen), was sich
nach erfolgtem Umzug jedoch selten in verstärkter Teilhabe am Gemeindeleben
widerspiegelt. Die Wanderungen
nach
Berlin erfolgen
wegen der gesuchten Nähe zu Bezugspersonen, der vorhandenen
Infrastruktur/Netzwerke sowie in Erwartung besserer Chancen auf dem
Wohnungs- und Arbeitsmarkt, weniger infolge der Unterordnung unter
tatsächliche Erfordernisse des Arbeitsmarktes, wie es bei anderen Ausländern
meist der Fall ist (de Riz 1979). Die Umzüge
im
kleinräumlichen Bereich
dien(t)en dann der
(u.U. weiteren) Verkürzung der räumlichen Distanz zu Angehörigen und dem
Bezug einer besseren, größeren oder zentraler gelegenen Wohnung (und
partiell bereits der "äußeren" Statuserhöhung). Mit dem Finden einer den
eigenen Vorstellungen entsprechenden Wohnung steigt bei vielen die
Zufriedenheit insgesamt. Der Wohnbereich genießt außerordentlich hohe
Wertschätzung als Nische, für die Kommunikation mit anderen und als einer
der wenigen wirklich selbstbestimmten Bereiche in der neuen Umgebung.
4.1.4 Familie, Sozialbeziehungen und
das "russische" Berlin
Für das Einleben der
Migranten in der neuen Umgebung ist nicht unwesentlich, ob sie allein oder
mit Familie gekommen sind, mit wem sie zusammen wohnen, ob sich in ihrem
Zusammenleben Veränderungen ergeben haben und über welche sozialen
Beziehungsnetze sie verfügen. Die Auswertung der Datensätze ergab für den
formellen Familienstand der Zuwanderer zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen
Einreise zunächst folgende Anteile:
|
Familienstand bei der
Einreise |
Personenzahl
(v.4.006 /1.12.95) |
von 100 %
aller ca: |
von 100% der
Volljährigen c |
| Verheiratet |
1.990 |
50
% |
58
% |
| ledig |
1.212 |
30
% |
18
% |
| geschieden |
406 |
10
% |
12
% |
| verwitwet |
398 |
10
% |
12
% |
Etwa die Hälfte der
gesamten Zuwanderergruppe war bei der Einreise verheiratet (ca.10 % davon in
einer 2.Ehe). Abzüglich der Minderjährigen liegt der Anteil Verheirateter
bei 58 %, der Lediger bei 18 % und der Geschiedener und Verwitweter jeweils
bei ungefähr 12 % aller volljährigen Personen
(72).
Verwitwete
Zuwanderer sind hauptsächlich in der Altersgruppe der über 65-jährigen zu
finden und hier zu etwa 70 % Frauen. Ein Teil dieser Frauen hat ihren
Partner bereits während des 2. Weltkrieges verloren und danach nicht wieder
geheiratet. Geschiedene Migranten überwiegen in der Gruppe der 30 -
50jährigen. Die Zahl ist angesichts der hohen Scheidungsrate in der
Sowjetunion noch relativ niedrig, erhöht sich aber entsprechend, werden die
Wiederverheirateten dazugerechnet.
Interessanterweise
reiste ein Teil der Zuwanderer mit seinem geschiedenen Partner ein. Daneben
ziehen verstärkt Personen zu, die nach einer Scheidung oder dem Tod eines
nahen Familienmitglieds in der GUS allein geblieben sind und hier bereits
Angehörige haben. Die jeweilige Gesamtgröße der eingereisten Familien -
gemessen an miteinander verwandten Personen - ist quantitativ nicht genau
feststellbar, da einzelne Familienmitglieder zu unterschiedlichen
Zeitpunkten eingereist sind und häufig nicht zusammen wohnen. Während in
andere Bundesländer im Rahmen des geregelten Verfahrens sehr oft ganze
Familienverbände zusammen einreisen und untergebracht werden, erfolgte der
Zuzug nach Berlin oft stufenweise: zunächst reisten Alleinstehende oder
Ehepaare mit Kindern ein und verbliebene Familienmitglieder ("alte" Eltern,
Geschwister) kamen später nach.
Die
Stuttgarter Untersuchung (IRG 1994, S.12), die auf den Zahlen der dort in
Wohnheime eingewiesenen Familien beruht, errechnete 29 % Alleinstehende, 17
% 2-Personen-Familien (i.d.R. Ehepaare), 30 % Familien mit 3 Personen (hier
meist die typische 1-Kind-Familie, die auch in Berlin überwiegt) und 24 %
Familien mit 4 - 7 Personen (vorrangig 3-Generationen-Konstellationen)
(73).
Für die
Berliner Zuwanderer näher feststellbar sind die Größen ihrer Privathaushalte
- gemeint sind hier alle Personen, die zusammen in einer Wohnung leben. Für
sie ergibt sich derzeit folgende Verteilung:
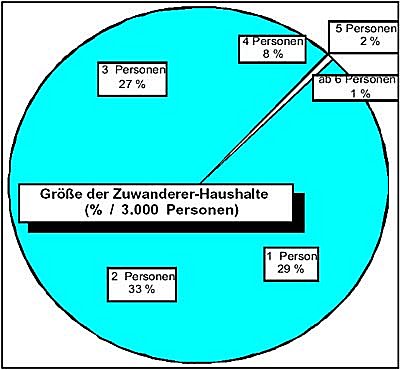
Die Haushalte mit nur
einer Person (29 %) setzen sich bei den Zuwanderern zu einem erheblichen
Teil aus älteren verwitweten Frauen und jüngeren alleinstehenden Männern
zusammen. Einen Teil dieser Gruppe machen auch geschiedene und getrennt
lebende Zuwanderer aus sowie Personen, deren Partner noch nicht eingereist
ist. Migranten aus dem asiatischen Teil der Sowjetunion wohnen dabei
signifikant seltener allein, als solche aus dem europäischen Teil. Ähnliche
Beobachtungen wurden in Österreich gemacht, wo bedeutend mehr orientalische
Juden leben als in Deutschland (Friedmann 1993, S.78). Die
2-Personen-Haushalte - mit 33 % anteilig die größte Gruppe - bestehen nicht
nur aus Ehepaaren, sondern auch aus alleinerziehenden Müttern, Vätern und
Großelternteilen (ca. 15 % aller Haushalte mit Kindern), Geschwistern oder
anders miteinander verwandten Personen. In den 3-bis über
6-Personen-Haushalten wohnen neben minderjährigen Kindern bei ihren Eltern
ebenso Eltern bei ihren volljährigen Kindern. Diese 2- oder
3-Generationen-Situation betrifft z.Zt. etwa 25 % aller
Mehrpersonenhaushalte. Es sind meist orientalische Familien oder Personen,
die über die Berliner Sonderregelung für Verwandte (siehe 2.2.) nach Berlin
gekommen sind (zur Jahresmitte 1995 waren dies bereits 23 % aller direkt
eingereisten Zuwanderer seit 1990); da sie einen schlechteren
Aufenthaltsstatus und keinen Anspruch auf einen Wohnheimplatz haben, wohnen
sie zunächst bei Verwandten.
Die Angaben zu den
Haushaltsgrößen beruhen auf der bei der Jüdischen Gemeinde jeweils
gemeldeten Zahl der Haushaltsmitglieder, die nicht immer korrekt angegeben
wird. Zweckwohngemeinschaften von nicht miteinander verwandten Personen und
Lebensgemeinschaften machen in der Statistik beispielsweise lediglich 2 %
aus. In der Praxis leben z.T. erheblich mehr Personen in den einzelnen
Haushalten - neben Verwandten sind dies häufig auch Bekannte/Freunde, die
sich mit verlängerten Touristenvisa, ohne Zuzugsgenehmigung oder
"nichtoffiziell" in Berlin aufhalten.
Insgesamt haben sich
die Haushaltsgrößen der zu Beginn der Migrationswelle Eingereisten jedoch
gegenüber dem Pretest 1993 bereits verkleinert.74
Kinder sind aus
der elterlichen Wohnung ausgezogen und Verwandte mit vorher unsicherem
Aufenthaltsstatus konnten eigene Wohnungen beziehen. Die Migration war für
viele Familien eine zu starke Belastung, häufig wollte auch nur einer der
Ehepartner ausreisen (siehe 2.3, 4.2.3); mit längerer Aufenthaltsdauer und
zunehmender Orientierung und materieller Sicherheit steigt nun auch die Zahl
derer, die sich hier - z.T. nach einer langen Ehe - trennen:
"Ich bin vor
fünf Jahren gekommen, mit Frau und Tochter. Wir waren lange im Wohnheim. Es
war verrückt, wir haben uns gestritten, ich hab auch etwas getrunken. Da bin
ich abends immer in diese Kneipen gegangen, wo alle möglichen Russen sitzen.
Wir haben uns scheiden lassen. Ich bin ausgezogen."
(A., Ingenieur, 44)
Häufig kommt es
bislang aber nicht zu einer Scheidung, u.a. aufgrund des hier langwierigeren
und kostspieligeren Scheidungsverfahrens. Um dieses zu vermeiden, lassen
sich einige Zuwanderer in der ehemaligen UdSSR scheiden. Dabei fällt auf,
daß nach der Einreise Geschiedene z.T. weiter zusammen wohnen. Drei
Hauptgründe werden dafür genannt: Kostenersparnis, weil keine alternative
Wohnung gefunden wurde oder weil man zwar nicht mehr miteinander verheiratet
sein will, jedoch in der fremden Umgebung zunächst die weitere Nähe zum
vertrauten früheren Partner einer räumlichen Trennung und der Isolation
vorzieht.
Eheschließungen nach
der Einreise sind noch relativ selten und finden dann meist in der Gruppe
der etwa 18 - 30jährigen statt, aber auch bei einigen Migranten mit bereits
erwachsenen Kindern (75).
Geheiratet wird
bis jetzt ausschließlich zwischen Zuwanderern, die nicht unbedingt der
jüdischen Gruppe, wohl aber der russischsprachigen angehören.
Es existiert neben
einer offiziellen Single-Gruppe in der Jüdischen Gemeinde (die hauptsächlich
aus älteren alleinstehenden Migranten-Frauen besteht) ein informeller
"Heiratsmarkt". Bei den Migranten aus dem asiatischen Teil der ehemaligen
Sowjetunion ist es daneben durchaus üblich, eine (meist jüdische) Frau dort
oder in Israel zu suchen, zu heiraten und nachträglich einreisen zu lassen.
Sie sind es auch hauptsächlich, denen die in der Jüdischen Gemeinde
registrierten Geburten von Neuzuwanderern seit 1990 zu verdanken sind:
Soweit von den Eltern gemeldet, erhöhte sich die Geburtenzahl von 5 Geburten
1990 sukzessive auf 21 Geburten im Jahre 1995 (siehe 5.1).
Diese jungen Familien
bemühen sich ebenfalls, aus dann meist überbelegten Wohnungen auszuziehen.
Daneben spielt für die "Schrumpfung" der Haushaltsgrößen eine Rolle, daß die
Großfamilien in der Sowjetunion häufig Notgemeinschaften waren, in denen
mehrere Generationen wegen Wohnraummangels in einem Haushalt lebten (vgl.
Mertens 1993,S.86) (76).
Hier nun zeigt
sich der Wunsch nach einer räumlichen Trennung hauptsächlich der Kinder von
den Eltern. Lebten diese in der Sowjetunion häufig bis zu ihrem Tod bei der
Familie, wird hier oft sehr schnell versucht, die Eltern in
Seniorenwohnungen oder -heimen unterzubringen (durchgängig ausgenommen die
orientalischen Familien). Familiensolidarität ist keine notwendige
Verpflichtung mehr, da wohlfahrtsstaatliche Leistungen (Heimunterbringung,
Pflegeversicherung etc.) auch für die Älteren greifen.
Während die Kinder
außerfamiliäre Möglichkeiten schnell annehmen, ist es für viele Eltern
problematisch, sich auf diese neue Situation einzustellen; häufig sind sie
ja nur wegen ihrer Kinder nachgezogen und um nicht allein zu sein (siehe
4.2.3). Ähnlich wie es einen scharfen Bruch bei der Beendigung des
Berufslebens für die Älteren gibt (der bei Jüngeren u.U. mit einer neuen
Arbeit aufgefangen werden kann), gibt es für sie kaum gleitende Übergänge,
wenn es um eine (räumliche) Trennung von der Familie geht. Häufig trennt
sich zeitgleich mit dem Auszug aus dem Wohnheim auch die Familie - Eltern
ziehen in ein Seniorenheim oder eine - wohnung, die Kinder in eine andere
Wohnung.
Das unterschiedliche
Tempo des Einlebens verändert jedoch auch die Stellung der einzelnen
Generationen innerhalb der Familie. Dem beschleunigten Lebensrhythmus der
Jüngeren steht ein verlangsamter der Alten gegenüber, der besonders durch
ihr kalendarisches Alter, d.h. die Beschränkung ihrer individuellen
Möglichkeiten (u.a. in bezug auf Arbeit) in der hiesigen Gesellschaft
bestimmt wird. Zudem haben sie häufig massive Sprach- und
Orientierungsprobleme, sind isoliert oder werden lediglich als
Kinderbetreuer von ihren Familien benutzt. Sie erleiden Autoritätsverluste
und können die neuen Normen/Werte, die das Verhalten ihrer Kinder und Enkel
z.B. bezüglich Konsum und Erziehung bereits zu bestimmen beginnen, nicht
nachvollziehen (siehe auch 4.2.3).
"Es hat sich
viel geändert. Tagelang sehen wir hier niemanden. In Moskau hatten wir ein
offenes Haus. Man kam einfach so vorbei.
[..]
Bei den
Deutschen muß man sich anmelden, am besten zwei Wochen im voraus. Sie sind
anders, nicht so spontan und herzlich. Meine Kinder haben das schon
übernommen. Sie haben auch keine Zeit mehr. Sie organisieren und planen und
schon ist der Tag um."
(M., Rentner, 75)
"Boris
[der Enkel]
hört mir
überhaupt nicht mehr zu. Früher war er immer nett, er war doch ein guter
Schüler und es kamen nie Klagen. Er wird immer frecher und kauft sich extra
zerrissene Hosen, aber das interessiert die Lehrer gar nicht. Man schämt
sich richtig. Bei mir darf er so nicht herumlaufen."
(F., Rentnerin, 63)
"Wenn ich diese
jungen Stiere sehe, wie sie zum Sozialamt marschieren. Ich sag ihnen: 'Was
sitzt ihr herum?' Das Geld
[die staatliche Hilfe]
macht
die Leute kaputt. Und es wird auf uns alle zurückfallen.Wie kann man denn so
leben. Das Materielle ist nicht alles.[..]
Ich
brauche gute Musik, gute Gespräche - das ist es, nicht das materielle. Aber
wer redet schon noch mit mir."
(G., Rentnerin, 76)
Auch wenn der Wunsch
nach einer räumlichen Trennung von den Eltern mit steigender
Aufenthaltsdauer immer deutlicher wird - was daneben am mangelnden Angebot
großer Wohnungen liegt, in denen mehrere Generationen zusammenleben könnten
- ist insgesamt auffällig, daß die Migranten danach streben, dennoch
weiterhin in der
Nähe
von Verwandten und
Freunden zu leben. Durch die Verteilungspolitik einiger Berliner
Wohnungsbaugesellschaften (etliche neugebaute Häuser sind fast
ausschließlich von Zuwanderern bewohnt) sowie die Vergabe von Wohnungen
durch die Jüdische Gemeinde (deren Wohnhäuser sich auf bestimmte Straßenzüge
beschränken) wird diese partielle Segregation unterstützt.
Ob dies langfristig
zum Hindernis für eine Eingliederung wird, bleibt abzuwarten; enge Kontakte
zwischen den Migranten können ebenso ihre Voraussetzung sein und räumliche
Segregation kann durchaus auch unabhängig von sozialer (kultureller,
sprachlicher etc.) Segregation bestehen. Amerikanische Studien zeigen, daß
ehemalige sowjetische Juden auch in den USA vorzugsweise distanziert "unter
sich" wohnen, andererseits aber deutlich höhere Positionen als andere
Einwanderergruppen auf der Ressourcendimension einnehmen (betr. Einkommen,
beruflicher Position, Bildung, Wohnen), d.h. sie dringen über ihre
spezifischen Handlungsdispositionen leichter als diese in das Statussystem
ein und verbleiben als Folge von externen Distanzierungen und internen
Bindungen deutlich segregiert (vgl. in Esser 1980,S.167).
Zu diesen internen
Bindungen
gehört "die ungewöhnliche hohe Bedeutung von Freundschaft und Zuneigung in
den persönlichen Beziehungen", die Studien in Israel den ehemaligen
Sowjetbürgern attestierten und hierbei zwei Bezugssysteme erkannten: "der
innere Kreis mit Familie und Freunden und der äußere Kreis der Bekannten und
Arbeitskollegen" (in Mertens 1993,S.135).
Der Telefon- und
Briefverkehr der Migranten mit Freunden und Verwandten in der GUS ist stark
ausgeprägt; auch Besuche dort sind häufig. Die älteren Migranten möchten
vorwiegend die Gräber ihrer Angehörigen besuchen; am meisten reisen jedoch
die 40 - 50jährigen (u.U. auch wegen geschäftlicher Interessen); am
uninteressiertesten an Besuchen in der früheren Heimat sind die bis etwa
25jährigen. Einige Zuwanderer äußern auch, das Land nie wieder betreten zu
wollen.
Für alle spielt jedoch
die Kommunikation mit Verwandten und Bekannten innerhalb Berlins eine
überragende Rolle - in Form von gegenseitigen Besuchen, Familien- und
Geburtstagsfeiern, die meist im häuslichen Bereich stattfinden, in
Abhängigkeit vom Einkommen und bei Längeransässigen auch in - z.T. eigens
angemieteten - Lokalen (77).
Bei den gegenseitigen
Beziehungen unter den Migranten gibt es jedoch recht scharfe Abgrenzungen.
DER SPIEGEL
schreibt: "Die
Nachfahren [der in den 20er Jahren nach Berlin exilierten Russen] haben
keine Mission, sie kämpfen um nichts, außer für sich selbst. Entsprechend
zersplittert ist die russische Intellektuellen-Szene. Sie zerfällt in
Küchenklubs und halböffentliche Zirkel.[..] Untereinander haben die Gruppen
keinen Kontakt" (3/1995 S.63f) - nach Meinung der Zeitung, um dem
"sowjetischen Geist" zu entgehen, vor dem sie geflohen seien und der sie
hier an einigen Orten wieder einzuholen scheine (ebd.). In Berlin hat sich
z.B. eine jüdische Gruppe der "Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges"
gegründet. Der Initiator - ehemals Parteisekretär eines großen Kombinates -
organisiert Ausflüge, Diskussionsabende und will mehr Rechte für sowjetische
Kriegsinvaliden in der Bundesrepublik durchsetzen. Andere Migranten
beobachten dies skeptisch:
"Da fragst Du
Dich, was wollen die hier. Erst haben sie gegen die Deutschen gekämpft und
jetzt sitzen sie alle hier, behängt von oben bis unten mit Orden und trinken
Wodka. Vom Judentum wollen sie nichts wissen. Die schwärmen von alten
Zeiten. Das sind doch alles Kommunisten."
(I., Ingenieurin, 41)
Ideologische
Differenzen oder Beschuldigungen als einzigen Grund bzw. Hauptgrund für
gegenseitige Abgrenzungen anzunehmen, wäre jedoch unkorrekt. Auch in den
Schulen bilden die Schüler Leningrader, Moskauer oder Dnepropetrowsker
Cliquen und bei Veranstaltungen distanziert sich (z.B.) die intellektuelle
Oberschicht deutlich von anderen. Die sowjetischen Juden bestehen aus einer
Vielzahl von Gruppen, sie kommen aus verschiedenen regionalen und sozialen
Kontexten, haben unterschiedliche Interessen und sehen sich selbst nicht als
homogene Gemeinschaft an (wie sie es bereits in der Sowjetunion nicht
taten); dies geschieht eher aus der "Außensicht" der Einheimischen).
Intensive Kontakte
bestehen in der neuen Umgebung dennoch meist nur zwischen ehemaligen
Sowjetbürgern und haben hier häufig Stütz- und Orientierungsfunktionen. Die
Kontakte mit Deutschen nehmen hingegen auch bei steigender Aufenthaltsdauer
kaum zu. Selbst Migranten, die bereits zehn bis zwanzig Jahre in Berlin
leben, haben nur sehr oberflächliche Beziehungen zu ihrer deutschen
Umgebung.
Die Kontakthäufigkeit
und -intensität zu Deutschen wie die Aktionsräume der Migranten hängen von
Sprachkenntnissen, beruflichen Voraussetzungen, Gelegenheiten, Bedürfnissen,
vom Alter, dem Vorhandensein von Kindern usw. ab und davon, ob die
Umgebungsgesellschaft einer Interaktion positiv gegenübersteht.
"Ich habe eine
Umschulung als Kaufmann gemacht. Jetzt bekomme ich wieder Sozialhilfe. Für
Russen will ich nicht arbeiten. Der Handel mit Rußland hat doch keine
Perspektive. Ich suche etwas, wo ich aufsteigen kann, eine deutsche Firma.
Ich glaube, ich bin gut, ja. Aber bisher hat mich keiner genommen."
(I., früher
Fotograf, 33)
Migranten mit
häufigeren Kontakten zu Deutschen sind Personen aus dem Kunst- und
Medienbereich, vereinzelt alleinstehende Jüngere, Eltern mit Kindern in
deutschen Kindergärten oder Schulen und die betreffenden Kinder selbst sowie
die wenigen Zuwanderer, die eine Arbeit bei deutschen Arbeitgebern gefunden
haben. Aber auch hier beschränken sich die Beziehungen fast ausschließlich
auf den schulischen oder beruflichen Bereich und werden nicht auf die
Freizeit ausgeweitet.
Die häufigsten und oft
einzigen Kontakte sind formeller Art und bestehen zu deutschen
Institutionen, an erster Stelle zum Sozialamt, zur Ausländerbehörde und zum
Arbeitsamt. Diese Behördenkontakte sind für die meisten unbefriedigend; die
Arbeit der Ämter bzw. die Mitarbeiter werden als unfreundlich, bürokratisch
und restriktiv wahrgenommen (ähnlich bei Friedmann für Österreich; 1993,
S.127):
"Keiner schaut
dich an oder sagt 'Guten Tag', nur: 'Was willst du hier, geh zurück nach
Rußland'. Man wartet den ganzen Tag und dann sagen sie, du sollst wieder
gehen. Die schicken einen nur hin und her. Wir sind für die Abschaum. Ich
schlafe tagelang nicht, wenn ich da hin
[Sozialamt]
muß."(B.,
Restauratorin, 45)
Obwohl sich der
Eindruck, diskriminiert zu werden, meist auf Behörden oder Arbeitgeber
bezieht, und u.a. in 45 Interviews, die für diese Untersuchung geführt
wurden, nur zweimal von engeren Beziehungen zu Deutschen berichtet wurde,
werden "die Deutschen" insgesamt eher negativ beurteilt. Während
(vermeintliche oder tatsächliche) Eigenschaften wie Weltgewandtheit,
Disziplin oder "technischer Verstand" bewundert werden, wird ihnen ansonsten
am häufigsten Gleichgültigkeit, Arroganz, Egoismus oder Humorlosigkeit
zugesprochen.
"Sie sind
anders als wir. Sie denken, sie sind besser, dabei fehlt ihnen die Seele.
Sie sind verkniffen, kalt.
[..]
Wenn wir
feiern, kommen sie sofort und beschweren sich laut und böse. Sie verstehen
unsere Kultur nicht. Das ist für mich das Wichtigste, was ich habe. So wie
die sind, will ich nicht sein."
(A., Dreher, 52)
Mißverständnisse,
Vorurteile und Schwellenängste bestehen auf beiden Seiten (siehe 4.2.2); zur
Abgeschlossenheit der Gruppe trägt jedoch maßgeblich bei, daß sich in Berlin
inzwischen beinahe eine Art "ethnic community" (u.a.Eisenstadt 1954) oder
"ethnische Kolonie" (Heckmann 1992) herausgebildet hat, die
selbstorganisiert und weitgehend unabhängig von außen ist. A., Friseuse, 36
Jahre:
"Zeig mir einen
[Migranten],
der
zu einem deutschen Friseur geht. Sie können nicht richtig mit denen reden
und außerdem ist es teurer. Ich bin billiger und komme nach hause.
[..]
Was sollen sie sich mit den Deutschen rumärgern oder mit dem Arbeitsamt. Sie
arbeiten bei den Leuten, die vor zwanzig Jahren gekommen sind. Die zahlen
nicht gut, aber es funktioniert, man verständigt sich.
[..]
Das ist doch
ganz einfach: Wenn ich Fisch brauche, gehe ich zu Mirkin
[jüdischer
Fischhändler],
wenn ich mich
ausheulen will, gehe ich zu Olga, wenn ich Ärger mit der Hausverwaltung
habe, komme ich zu Euch
[Sozialberatung
Jüdische Gemeinde]. [..]
Mein Deutsch
ist nicht schlecht, aber wann brauche ich das? Politik interessiert mich
nicht. Wenn ich Deutsche kennenlerne, gut, wenn nicht, auch gut. Ich habe
meinen Kreis. Ich habe russisches Fernsehen, will ich ausgehen, kann ich das
jeden Tag. Hier treten alle irgendwann auf, die ich von früher kenne."
Berlin ist die einzige
Stadt in der Bundesrepublik mit einer derartig ausgeprägten "Kolonie". DER
SPIEGEL zählt 70.000 bis 100.000 ehemalige Sowjetbürger (allerdings mit
deutschen Aussiedlern) in der Stadt und konstatiert, die Migranten hätten
sich "in der fremden Großstadt ein kleines Rußland aufgebaut"
(35/1995,S.61).
Berlin bot dazu ideale
Ausgangsbedingungen. In beiden Stadthälften lebten bereits früher viele
ehemalige Sowjetbürger; die Migranten konnten in Ostberlin auf
weiterbestehende Einrichtungen der DDR zurückgreifen (z.B. Haus der
sowjetischen Kultur; Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft,
russischsprachige Bibliotheken) und in Westberlin auf informelle
Verkehrskreise, auf Angebote etablierter Migranten in bezug auf
Dienstleistungen (Ärzte, Dolmetscher, Rechtsanwälte usw.) oder als
Arbeitgeber (in Handelsfirmen, Spielhallen, Läden, Arztpraxen). Hinzu kam
die institutionell starke Jüdische Gemeinde, die ihre Einrichtungen und
Möglichkeiten den neuen Migranten öffnete (Kindergarten, Schule,
Seniorenheim, Krankenhaus, Sozialberatung, Wohnungen, Arbeitsplätze usw.).
Im Zuge der
Masseneinwanderung seit dem Berliner Mauerfall hat sich nicht nur die Zahl
der russischsprachigen Migranten sprunghaft erhöht, sondern vor allem ist
die "Verwandtschaftsdichte" (Heckmann 1992) infolge der Kettenwanderung
enorm gestiegen und wurden Beziehungen (auch von ehemaligen Nachbarn,
Kollegen, Freunden) aus dem Herkunftskontext nach Berlin "verpflanzt" - für
einige orientalische "Berliner" Familien sind familiäre Netzwerke mit
jeweils mehr als 50 Personen nachweisbar.
Infolgedessen wurden
die Formen der Selbstorganisation stark ausgebaut, die für die Migranten
nicht nur Selbsthilfe in sozio-ökonomischer Hinsicht und gegenüber der
relativ geschlossenen Mehrheitsgesellschaft sind, sondern auch eine Funktion
für die Persönlichkeitsstabilisierung und den Vergleich mit anderen haben.
Auch wenn das "kleine Rußland" (in dem Nicht-Russen die Majorität sind)
nicht an die institutionelle Vollständigkeit des russischen Vorkriegsberlin
anknüpfen kann und sich auf bestimmte Gegenden konzentriert, kann es in
seiner Gesamtheit inzwischen die meisten Bedürfnisse decken; umso
verständlicher wird, daß Migranten gerade nach Berlin zuziehen wollen.
Es existiert bislang
keine vollständige ethnische (Dienstleistungs)Ökonomie, jedoch eine
"Ergänzungsökonomie" (Heckmann 1992), die auf die spezielle Nachfragen der
Migranten reagiert und von einheimischen Anbietern nicht gedeckt wird (z.B.
Verleih/Verkauf russischsprachiger Videos, Bücher, Computersoftware;
Export/Import, Versicherungen, Makler, Übersetzungsbüros), sowie eine
"Nischenökonomie" (Heckmann 1992), die gleichzeitig auf die Nachfrage der
Umgebungsgesellschaft zielt, z.B. Lebensmittelhandel, Schuster-, Schneider-,
Reparaturwerkstätten, Reisebüros, Galerien, Restaurants und Imbisse.
Den Bedürfnissen in
der Migrationssituation und der eigenen Interessenvertretung in der
unterlegenen Position der Majorität gegenüber, dienen verschiedene
Vereinsgründungen wie der "Club Dialog e.V.", "russki Berlin e.V." oder die
"Gesellschaft der Wissenschaftler", die seit Januar 1996 emigrierten
sowjetischen Akademikern den Einstieg in die Wissenschaftssphären der
Bundesrepublik erleichtern will.
Einrichtungen, die
Arbeitsplätze geschaffen haben und denen gleichzeitig für die weitere
kulturspezifische und religiöse Sozialisation Bedeutung zukommt, sind bei
der Russisch-orthodoxen Kirche z.B. die "Sonntagsschule" (wo Kinder Russisch
lernen können) und auf der "jüdischen Seite" ein Jüdisches Migrantentheater
und Vereine mit Beteiligung von Migranten wie der Jüdische Kulturverein
(dazu weiter siehe 5.Kapitel).
Daneben entstanden
seit 1990 in Berlin im Zuge hauptsächlich der jüdischen Migration u.a. das
"Russische Kulturprogramm" (2 mal wöchentlich im Lokalfernsehen
ausgestrahlt), eine tägliche russischsprachige Radiosendung
(SFB-Multikulti-Kanal), die erste russischsprachige Wochenzeitschrift für
Emigranten nach dem Krieg ("Evropa-centr") und die Literaturzeitschrift
"Ostrov". Neben Büchern auf Russisch existieren inzwischen auch
Gemeinschaftsproduktionen wie die in Ludwigshafen von Aussiedlern, Russen,
sowjetischen Juden und Deutschen herausgegebene russisch- und
deutschsprachige Monatszeitschrift "Neues Leben -
JSPZFP".
Besonders diese
Zeitungen belegen die Bedürfnisse und Probleme der russischsprachigen
Migranten bzw. die Bereiche, auf die sie sich spezialisiert haben: Sie sind
zum einen ein "Readers Digest" von Zeitungen aus der Heimat und der
Bundesrepublik, befassen sich u.a. mit Fragen des deutschen Rechtssystems
(z.B. Versicherungen), dem problematischen Zusammenleben mit Deutschen und
von russischsprachigen Ethnien in Deutschland untereinander und haben große
Annoncenteile.
Neben der Offerierung
von Dienstleistungen und Waren aller Art, fallen die vielen Anzeigen
hiesiger russischer Reisebüros (Flugtickets, Visaerledigung in alle Teile
der früheren UdSSR etc.) und die Heiratsannoncen besonders auf: meist wird
hier entweder allgemein ein(e) russischsprachige(r) Partner(in) gesucht oder
es geht recht eindeutig um eine Wohnortverlegung, d.h. eine Person mit
Noch-Wohnsitz in der GUS "möchte jemanden mit ständigem Wohnort in
Deutschland kennenlernen" (u.a. "Neues Leben - Kurier" 2/96).
4.2 Psychosoziale
Aspekte
Die Art der
Sozialbeziehungen der Migranten deutet an, daß sich mit dem Wechsel ihrer
soziokulturellen Umgebung mehr als nur ihre "objektiven" Lebensumstände
geändert haben. So beziehen sich die folgenden Abschnitte auf einige
Probleme und Fragen, die im weitesten Sinne den emotionalen, kognitiven,
ethnisch-moralischen/religiösen Bereich betreffen - das Verhältnis zwischen
Umgebungsgesellschaft und Migranten, den Umgang mit Identitäts- und
Biographiebrüchen, neuen Lebenssituationen, Werten und Normen. Die
Ausführungen basieren auf Interviews und Einzelaussagen von Zuwanderern, auf
Beobachtungen, die in der Sozialarbeit der Jüdischen Gemeinde gemacht wurden
und der Auswertung entsprechender Literatur.
4.2.1 Zur Stellung der Migranten als
Juden und Ausländer
Der Anteil der Juden
an der Gesamtbevölkerung in Deutschland beträgt trotz der Zuwanderung
bislang nur etwa 0,1 %. Trotz der geringen Zahl in Deutschland lebender
Juden und obwohl (oder gerade weil) nur wenige Nichtjuden persönliche
Kontakte zu Juden haben, halten sich antisemitische Einstellungen hartnäckig
und äußern sich partiell auch in manifester Diskriminierung.(78)
Fünfzig Jahre nach dem
Ende des "Dritten Reichs" können sich lt. Forsa nur 54 % der (1.509
befragten) Deutschen einen Juden als Bundeskanzler vorstellen, halten 63 %
"Geschäftstüchtigkeit" noch immer für das hervorstechende Merkmal von Juden
und sind (neben 15 % Unentschlossenen) 41 % gegen die weitere Aufnahme von
Juden aus der Ex-UdSSR (Die Woche 26.1.1996).
Daß über die Hälfte
der Befragten der jüdischen Einwanderung ambivalent oder ablehnend gegenüber
steht, muß für sich gesehen nicht auf eine judenfeindliche Haltung schließen
lassen, wohl aber auf den Wunsch, den Zuzug von Ausländern zu stoppen - ein
Konsens, den weite Teile der Bevölkerung teilen.
Die Gleichgültigkeit
oder Ablehnung gegenüber "Fremden" ist nicht zuletzt Ergebnis einer
politischen Kultur, die sich an unrealistischen Forderungen ("Einwanderung
für alle") Linker wie dem "Daueralarm" professioneller
Ausländer-/Judenfreunde einerseits und einem enttabuisierten
Rechtspopulismus andererseits polarisiert, der vor dem Hintergrund sozialer
Krisen und von Überfremdungsangst imaginäre überschrittene
Ausländerquantitäten beschwört und "Blut-und- Boden-Logik" propagiert.
Dennoch konnten sich
auch die Befürworter einer Abschottungspolitik nicht leisten, die Aufnahme
sowjetischer Juden abzulehnen und die - für "unsere jüdischen Mitbürger" -
sensibilisierte Öffentlichkeit oder diese selbst zu provozieren. Die Haltung
zu Juden wurde in der Bundesrepublik instrumentalisiert und
funktionalisiert; das Verhältnis zu ihnen gilt als Gradmesser für
"bewältigte" Vergangenheit, politische Seriösität und aufgeklärte, tolerante
Einstellungen gegenüber Minoritäten, selbst wenn die Grundlagen von
Antisemitismus und Xenophobie nicht prinzipiell in Frage gestellt werden
oder Abneigungen gegen Juden/Ausländer weiterbestehen.(79)
Die jüdische
Einwanderung wurde so aus einer "Verantwortung der deutschen Geschichte
gegenüber" (siehe 2.2) und zeitgleich mit den emotional aufgeheizten
Debatten um die Novellierung (Verschärfung) von Ausländer- und Asylgesetz,
stillschweigend toleriert und geregelt. Die Aufnahme jüdischer Migranten ist
begrüßenswert, jedoch führt sie eine Ausländerpolitik einmal mehr ad
absurdum, die mit zweierlei Maß mißt und in diesem Fall die Opfer von einst
bzw. deren "Stellvertreter" oder Nachfahren nunmehr besser als andere
"Fremde" behandelt (was leicht auch ins Gegenteil umschlagen kann). Aber
gleichzeitig verweisen die ausgesprochen schleppende Bearbeitung der
Einreiseanträge, die Abweisung von Personen, die außerhalb des offiziellen
Verfahrens einreisen (d.h. daß quasi der Antragsweg über
Bedrohung/Nichtbedrohung, Aufnahme/Nichtaufnahme entscheidet) und
ausländerrechtliche Beschränkungen auf die Halbherzigkeit der Entscheidung
und die ethnienübergreifende Abwehrhaltung der aktuellen Migrationspolitik
(siehe 2.2).
Für die Migranten
selbst sind die Diskrepanzen im Umgang mit Ausländern/Juden in der
Bundesrepublik weniger ein politisches als ein praktisches Problem. Ihr
gleichzeitiger Status als Juden und Ausländer macht sie in doppelter Weise
zum möglichen Zielobjekt von Diskriminierungen. Als Juden äußerlich nicht
erkennbar, werden sie zunächst eher als Ausländer mit Ablehnung
konfrontiert:
"Daß
Deutschland vor allem in den letzten Jahren antisemitisch geworden ist, weiß
ich vom Hören. Daß es ausländerfeindlich ist, weiß ich aus eigener
Erfahrung, zum Beispiel wenn man in Restaurants anders bedient wird als die
Deutschen, weil man nicht so gut Deutsch spricht.
[..]
Das ging gleich
am Anfang los. Kaum war ich angekommen, haben mich irgendwelche Leute
abschätzig angesehen und gemeine Bemerkungen gemacht."
(G., Lehrerin, 34)
Besonders häufig
berichten Migranten, deren Aussehen sich von durchschnittlichen
Mitteleuropäern unterscheidet, von verbalen oder tätlichen Angriffen. Der
Grad der Sprachbeherrschung scheint relativ unerheblich zu sein, da sowohl
Zuwanderer, die schlecht deutsch sprechen, als auch solche, die lediglich
noch an einem Akzent als Ausländer zu erkennen sind, Diskriminierungen
erfahren.
Mit steigender
Aufenthaltsdauer nimmt die Zahl von rassistisch oder antisemitisch
motivierten Vorfällen zu. Zunächst sind es häufig Ereignisse, die mit dem
Leben im Wohnheim zusammenhängen (Angriffe von Personen aus der Umgebung
oder Auseinandersetzungen mit Bewohnern verschiedener Ethnien)
(80).
Später und mit
zunehmender Sprachkompetenz werden vermehrt verbale Vorfälle aus dem Wohn-,
Behörden-, Freizeit- und Arbeitsumfeld berichtet:
"Der Mann, der
unter uns wohnt, hat mich immer freundlich gegrüßt. Irgendwann hat er mich
gefragt, wo ich herkomme. Ich hab ihm gesagt, daß ich aus Riga bin. Er hat
dann gefragt, ob ich Deutscher bin - bestimmt, weil ich einen deutschen
Namen habe. Als ich ihm gesagt habe: 'Nein, ich bin Jude.' hat er sich
einfach umgedreht und ist weggegangen."
(W., Jurist, 56)
"Ich bin doch
nicht schlechter als die anderen, warum verstehen die das denn nicht. Ich
finde es blöd, wenn sie immer 'Russe!' oder 'Jude!' rufen und dabei lachen."
(P.,
Schüler,14)
Meist werden negative
Erfahrungen jedoch nicht als gegen die eigene Person gerichtet wahrgenommen,
sondern gegen "Juden allgemein" - eine Beobachtung, die auch aus den
Zwischenresultaten der Umfrage des Steinheim-Instituts und
Mendelsohn-Zentrums hervorgeht (Schoeps 1993)
(81).
Daneben hatten
68 % der dort Befragten bisher keine
direkten
antisemitischen
oder ausländerfeindlichen Erfahrungen in Deutschland gemacht
(82).
Die Abwehr von Teilen
der Bevölkerung gegen Ausländer/Juden darf nicht hochgespielt werden,
dennoch muß bemerkt werden, daß subtilere Formen von
Rassismus/Antisemitismus von den Zuwanderern häufig nicht wahrgenommen (vgl.
Duwidowitsch 1993,S.8f), nebenbei registriert oder nicht als solche
angesehen werden (z.B. wurden Hetzflugblätter, die Migranten in ihren
Briefkästen fanden, für Werbung gehalten (83)).
In anderen Fällen ist die Jüdische Gemeinde Ersatz-Adressat für
Diskriminierungen oder fängt sie auf, ohne daß die Migranten selbst damit
konfrontiert werden. In den Gemeinden gehen in erheblichem Umfang Drohanrufe
und -briefe ein (immer seltener anonym) und müssen sich Mitarbeiter, die mit
Behörden und Einzelpersonen zusammenarbeiten, mit Vorurteilen, Ablehnung
oder einfach nur Unwissenheit bzw. Unsensibilität auseinandersetzen: Die
Palette reicht von der schriftlich mitgeteilten Entscheidung einer
gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft, "für diesen Personenkreis keine
Wohnungen zur Verfügung zu stellen", über Neidäußerungen ("wir können auch
nicht einfach irgendwo hinkommen und abkassieren"), Beschuldigungen ("die
haben sich ihre gute Stellung als Flüchtling erschlichen") bis zu
Vorurteilen über ansässige wie neugekommene Juden ("man weiß doch, daß die
Juden reich sind, wieso sollen wir da helfen"; "das Betrügen liegt denen so
im Blut" usw.).
Auch wenn Migranten
selbst nicht mit spektakulären Vorfällen oder den versteckten, impliziten
Formen der Ausgrenzung konfrontiert wurden, rufen Übergriffe auf Ausländer,
Wohnheime, Friedhöfe oder Synagogen und die Wahrnehmung von wie
Hochsicherheitstrakts bewachten jüdischen Einrichtungen bei vielen
Verunsicherung hervor und gehören zu einer Realität, die sie nicht erwartet
haben (siehe 2.3.).
"Ich dachte, so
etwas
[Antisemitismus]
gibt es nur bei
uns. Meine Eltern haben gesagt, wir kommen jetzt in die Freiheit,
Deutschland hat uns eingeladen.
[..]
In der Schule,
da stehen immer Polizisten mit Pistolen vor der Tür und überall sind Gitter.
Ich glaube, das ist wohl alles wegen dem Haß und weil die Leute das Judentum
nicht verstehen."
(P., Schüler, 14)
"Als das in
Rostock passierte, wo die Faschisten das Wohnheim angezündet haben und die
Menschen waren noch alle drin, und keiner hat geholfen, da habe ich Panik
bekommen. Ich dachte: das hätte uns auch passieren können. Unser Wohnheim
hat so ähnlich ausgesehen und mir sind die Schmierereien eingefallen, die an
der Bushaltestelle standen: 'Juden raus'. Ich hab das damals nicht ernst
genommen. Jetzt mache ich mir schon Sorgen."
(N., Chemikerin, 42)
Zu dieser neuen
Realität gehört die Aktualisierung einer internalisierten Vorsicht, ein
antizipatives, an die Umwelt angepaßtes Verhalten. In jüdischen Jugend- und
Schulberatungsstellen berichten Eltern, daß bereits ihre Kinder an jüdischen
Feiertagen (an denen sie schulfrei hätten) zur Schule gehen oder den
christlichen Religionsunterricht (von dem sie befreit sind) besuchen wollen,
um sich nicht von anderen Kindern zu unterscheiden. Erwachsene setzen - wie
die einheimischen Juden - die Kippa (Kopfbedeckung) auf der Straße sofort
ab, erkundigen sich nach Sicherheitsvorkehrungen in den jüdischen
Einrichtungen. Einige möchten keine Post mit Stempeln der Gemeinde bekommen,
andere fragen nach, ob sie bei Behörden sagen können, daß sie Juden sind
oder es besser verschweigen sollen.
Die Einschätzung ihrer
neuen Umgebung fällt vielen umso schwerer, als sie Ablehnung, Ignoranz und
Zuwendung gleichermaßen erfahren. Zunächst hat die jüdische Immigration die
faktische Unsichtbarkeit der Juden in Deutschland teilweise aufgehoben und
sie in das Wahrnehmungsfeld der Umgebung gerückt: Jüdische Kultur, jiddische
Musik, jüdische Restaurants, Jiddisch-Sprachkurse oder schlicht "Juden" sind
"in" und auch einige Migranten profitieren davon, weil sie diese
"Marktlücken" z.T. füllen können. Gleichzeitig wurde von (nichtjüdischen)
Gruppen/ Institutionen umgekehrt ein Handlungsbedarf zur
Interessenvertretung der Zuwanderer entdeckt: deutsche Ausländervereine
eröffneten "jüdische Filialen", deutsche Reisebüros bieten russischsprachige
Reisen an und Sprachschulen Kurse, die auf sowjetische Juden zugeschnitten
sind.
In der praktischen
Arbeit mit jüdischen Migranten fällt auf, daß auch Einzel- bzw.
Privatpersonen verstärkt Interesse an den Migranten zeigen: Hilfe aller Art
anbieten, Patenschaften übernehmen, Filme drehen, Dissertationen oder
Interviews machen wollen (84).
Die anfängliche
Anziehung und Anteilnahme schlägt hier jedoch häufig in Distanzierung um und
der Vorrat an gutem Willen nimmt schnell ab. Die Vergleiche zwischen den
Migranten und ihrer Großelterngeneration sind irreführend und auf beiden
Seiten Quelle ständiger Mißverständnisse und Desillusion. Viele reagieren
enttäuscht, wenn sich die romantischen und folkloristischen Vorstellungen,
die sie auf "ihre" Juden projizieren, nicht erfüllen oder wenn sich
Leerstellen über eine Identifizierung mit dieser Gruppe nicht kompensieren
lassen. Genau die am häufigsten beobachtbaren "Wunsch"-Vorstellungen treffen
auf die Zuwanderer am wenigsten häufig zu: KZ- oder Pogrom-Erfahrung,
Jiddisch-Kenntnisse, traditionell-jüdische Lebensweise, überschwengliche
Dankbarkeit über oder Zufriedenheit mit dem Ausmaß der Hilfe in der
Bundesrepublik etc. An ihren tatsächlichen Problemen und an
"Normalbiographien" ist seltener jemand interessiert. Es drängt sich auch
den Migranten der Eindruck auf, daß sie hier häufig nicht als real
existierende Individuen, sondern als Gruppenbestandteil "gemocht" werden
oder als Vorzeigeobjekte dienen sollen. Larissa (Bibliothekarin, 47 Jahre):
"Als wir im
Lager wohnten, haben wir über die Gemeinde eine deutsche Familie
kennengelernt, die Juden helfen wollte. Sie haben sie uns eingeladen und uns
überall herumgezeigt: 'Das sind Juden aus Rußland!' - wie Wundertiere und
als ob sie etwas Unglaubliches tun, wenn sie sich mit uns abgeben. Geholfen
haben sie uns nicht. Damals hätten wir wirklich alle Hilfe gebraucht. Das
war ihnen wohl zu anstrengend. Die haben uns jiddische Musik vorgespielt.
Ihr Sohn singt sogar die Lieder nach: 'A jiddische Mame'
[Eine jüdische Mutter]
und
so. Von der 'jiddische Mame Larissa' wollten sie aber nichts wissen, nur
irgendwelche Leidensgeschichten hören. Gott sei Dank, haben wir nichts
furchtbares erlebt. Die Sorgen, die wir haben, die haben wir hier und das
hat nichts damit zu tun, daß wir Juden sind. Das hat ihnen wohl nicht
gepaßt. Wir haben nicht viel erwartet, aber sie hatten dann nicht mal Zeit,
einen Brief auf Deutsch für uns zu schreiben. Mein Mann sagt immer: 'Die
wollten den Gefillte Fisch
[jüdische
Spezialität],
aber ohne
Gräten'."
Die Migranten leiden
an ihrer Entwurzelung, ihrem Heimatverlust, ihren eigenen Ambivalenzen und
haben sich gleichzeitig, wie die einheimischen Juden, zwischen einem Besser-
oder Schlechter- Sein-Sollen als alle anderen zu definieren. Es ist auch für
sie schwierig, zwischen dieser Mischung aus Verdrängung und Verklärung (wie
Subventionierung) auf der einen bzw. offener oder verdeckter Ablehnung auf
der anderen Seite die ebenso vorhandene "Mitte" zu finden sowie eigene
Abgrenzungen und Fehlurteile zu hinterfragen (z.B. werden mitunter
unpopuläre Entscheidungen von Behörden als antisemitisch denunziert bzw.
versteigen sich einige in Opfer-Rollen).
4.2.2 Probleme der ethnischen
Zugehörigkeit und Identität
Die Migranten stehen
in einem Spannungsfeld zwischen drei ethnischen Kulturen bzw. Identitäten
(individuell und auf die jeweilige Kultur bezogen in unterschiedlichem
Maße): der Kultur der Majorität ihrer jeweiligen Herkunftsregion, der der
eigenen jüdischen Ethnie und der der Majorität des Aufnahmelandes
(85).
Zunächst sind die
Migranten, unabhängig von subjektiven Interpretationen der Einzelnen, tief
von ihrer bisherigen sowjetischen Umgebung(skultur) geprägt und in ihr
verwurzelt, selbst wenn diese sie nur teilweise akzeptiert hat (siehe 3.4).
Die Stigmatisierung durch die Umgebungsgesellschaft hat ihre vollständige
Zuwendung und Angleichung an die majoritäre Umgebung wiederum verhindert.
Gleichzeitig sind die meisten in bezug auf ihre jüdische Identität in einem
kulturellen Vakuum aufgewachsen; es wurde ihnen aufgezeigt, daß auch eine
Hinwendung zum Judentum negative Folgen für die Biographie haben würde und
weiter wurde die Erhaltung des Judentums staatlich massiv behindert. Aus
dieser Lage heraus orientieren sich die Einzelnen (negativ wie positiv) an
beiden Kulturen/ Gruppen, gehören aber weder der einen noch der anderen
Gruppe eindeutig an.
"Ich bin in
Moskau geboren.
[..]
Daß ich Jude bin, stand in meinem Paß. Wenn ich es vergessen habe, haben
mich die anderen daran erinnert.
[..]
Inzwischen ist
mir schon ziemlich egal, was ich bin."
(G.,Schneider)
Die mehrmalige
Veränderung der Territoriumsgrenzen, die gewollte oder ungewollte Mobilität
der sowjetischen Juden, ihre Verbindung mit anderen Ethnien macht einen Teil
von ihnen nicht nur zu Wanderern zwischen zwei, sondern mehreren Welten.
"Großmutter hat
mir deutsch beigebracht, sie kommt aus Tschernowitz, ich hab also etwas von
der deutschen Kultur. Ihr Mann war auch aus der Bukowina. Mein Vater und ich
- wir sind in Kiew geboren, in der Ukraine. Mütterlicherseits kommen sie
aber eigentlich aus Rußland. Im Krieg sind sie nach Mittelasien evakuiert
worden. Da hat meine Oma einen Usbeken geheiratet und meine Mutter ist auch
da geboren. Hätte sie nicht einen Studienplatz in Kiew bekommen, wär sie
bestimmt dort geblieben. Sie ist dann nach Israel gegangen, das ist ihr
näher.[..]
Wo
ich hingehöre, weiß ich selber nicht."
(O., Schauspielerin,
28)
Aus dem
Interviewausschnitt wird noch einmal deutlich, daß die Sowjetunion ein
Vielvölkerstaat war, in dem neben der beherrschenden sowjetisch-russischen
Ethnie/Kultur auch zahlreiche andere beheimatet waren, die die sowjetischen
Juden je nach ihrem Lebensmittelpunkt mitbeeinflußt haben und ein Teil ihrer
Identität sind. Dieser Umstand wird in ihrer neuen Umgebung mit der
Bezeichnung "russische Juden" oder einfach "Russen" i.d.R. unterschlagen
(siehe 3.1 kommt nur etwa 1/3 überhaupt aus Rußland). Möglicherweise ist es
auch gerade die Zuschreibung "Russe", die die Migranten veranlaßt, zu
betonen, daß sie ukrainische, usbekische, lettische oder moldawische Juden
sind. Aber auch die Juden aus Rußland verwahren sich gegen die Reduzierung
"Russe", die eine Begrenzung auf etwas markiert, das sie nicht sein wollen
und nicht (oder nur partiell) sind (86):
"In Rußland war
ich die 'Jüdin', hier bin ich die 'Russin'. Ich kann nicht sagen, daß mir
das besser gefällt. Das ist auch wieder so negativ."
(T., Geologin, 35)
Mit ihrer Migration
nach Deutschland wird die Frage nach ihrer Gruppenzugehörigkeit - zunächst
von außen - neu gestellt. Unter 3.4 war davon die Rede, daß das Judentum in
der Sowjetunion nicht als Religion, sondern als Nationalität definiert ist.
Nach deutschem Rechtsverständnis wird es nach der Erfahrung mit absurden
Rassentheorien und ihren Folgen ausschließlich als Religionszugehörigkeit
gesehen, beruht somit theoretisch auch auf einer freien Entscheidung für
oder gegen diese Religion und bleibt damit eher "privat". Dies kollidiert
wiederum mit der jüdischen Auffassung, die von einer Doppelzugehörigkeit von
Religion und Volk ausgeht und sie nach der Halacha, dem jüdischen Gesetz, an
die jüdische Mutter bindet. Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren
wurde (und bleibt es, ob religiös oder nicht, kann also nicht aus dem
Judentum "austreten") (87).
Institutionen - auch
jüdische - haben sich an "juristische" Formalia zu halten. Diese Art der
Einordnung der Migranten als Juden (oder Nichtjuden) und die Differenzen und
Konfusionen zwischen drei Auffassungen sind für die Zuwanderer jedoch formal
wie inhaltlich folgenreich (88).
"Ich dachte
immer, ich bin Jude. Plötzlich soll ich keiner mehr sein. Den Russen war es
egal, wer meine Mutter ist. Judenpack ist Judenpack."
(D., Bautechniker, 49)
"Mich haben sie
aufgenommen
[in die Jüdische
Gemeinde],
aber meine Frau
und meine Kinder nicht. Ich verstehe das nicht, wir sind doch eine Familie.
Was soll nun werden?"
(A., Uhrmacher, 38)
"Ein Deutscher
hat mich mal nach religiösen Sachen gefragt. Ich hab ihm gesagt: 'Ich hab
keine Ahnung, ich bin Atheist'. Da war der ganz verwundert und sagte: 'Dann
sind Sie ja gar kein Jude'."
(V., Physiker, 56)
Die meisten Migranten
definieren sich nach dem sowjetischen Recht - als "Nationaljuden"
(gleichgültig ob die Mutter oder/und der Vater jüdisch war). Ein religiöser
Bezug spielt selten eine Rolle. Die deutsche (offizielle) Einordnung über
die Religionszugehörigkeit ist aus diesem Kontext für sie nicht
nachvollziehbar. Noch weniger nachvollziehbar ist es den Migranten, wenn die
eigene bzw. vermeintlich eigene Ethnie sie nicht als Juden akzeptiert.
Selbst wenn sie kaum Bezüge zum Judentum haben, wird dies als neuerliche
Ausgrenzung empfunden und bedroht ihr Selbstwertgefühl.
Aber auch jene, die
formal von den Gemeinden als Juden anerkannt werden, haben Probleme, von
deren Mitgliedern akzeptiert zu werden (siehe 5.3). Zumindest die Jüngeren
haben meist nie zuvor eine Synagoge betreten, kennen die Riten, Gebräuche
und Traditionen kaum und werden belächelt oder beargwöhnt. Neben den
Einheimischen grenzen sich auch längeransässige Migranten gegen die neu
Angekommenen ab, um ihre eigene Zugehörigkeit zur (jüdischen)
Mehrheitsgesellschaft zu demonstrieren oder weil die "Neuen" eine Konkurrenz
darstellen.
"Manche
deutsche Juden sind so arrogant. Neulich erzählt mir einer, daß seine
Familie schon dreihundert Jahre hier ist und daß sie ein großes Haus hatten
und alle bekowet
[ehrenhaft]
waren und
ehrlich und voller Kultur und bekannte Rabbiner und alles. Hab ich ihm
gesagt: 'Nu was glaubst Du:
Ich
bin
vom Himmel gefallen?' Sie denken, sie sind was besseres und müssen uns erst
alles beibringen."
(L., Rentner, 70)
Es gibt viele
russische Juden, die was für ihre Bekannten tun, aber nicht für alle. Auch
in der Gemeinde: es finden immer Fahrten statt. Viele fahren zweimal im
Jahr, andere überhaupt nicht, das ist ungerecht. Ich bin schon zweimal
abgelehnt worden, weil ich noch nicht lange da bin und keinen kenne."
(P., Schüler, 14)
"Am Anfang war
ich mal da und wollte 'Weihnachtsgeld'. Da hat die Frau
[in der
Sozialabteilung]
gefaucht, ob
wir hier bei den Christen sind. Aber
sie
wußte und
ich
wußte, daß die anderen Geld bekommen haben. Ich hab nur den Namen
verwechselt. Es war zu diesem
[jüdischen]
Neujahr."
(G.,
Ingenieur, 40)
"Die Gemeinde
will die Zuwanderung. Ob sie die Zuwanderer auch will, na, ich weiß nicht."(G.,
Lehrerin, 34)
Ähnlich wie bei der
oben erwähnten Unsicherheit vieler Migranten, nicht zu wissen, ob ihre
deutsche Umgebung sie ablehnt oder nicht, können sie sich hier nicht ganz
sicher sein, inwieweit sie zur jüdischen Gruppe gehören. Green vermutet:
"deutliche Ablehnung ist vermutlich leichter zu ertragen als unsichere und
unvorgesehene Akzeptanz" (in Heckmann 1992, S.203).
Die Migranten, die
sich von der Ausgrenzung durch einige Gemeindemitglieder abschrecken lassen
und diejenigen, die am Judentum desinteressiert sind, verbleiben mehr oder
weniger stark ihrer bisherigen (nicht-jüdischen) Orientierung verhaftet und
haben in Berlin zumindest eine bestehende russischsprachige Gemeinschaft.
"Ich bin
eingetreten
[in die Gemeinde],
weil die helfen mit der Wohnung und alle hingegangen sind. Sonst hab ich
damit nicht viel zu tun. Ich habe meine Freunde, ich lebe weiter wie
bisher."
(G., Ingenieur, 40)
Die ethnischen
Grenzziehungen, die in der Sowjetunion üblich waren, werden jedoch auch hier
u.U. aktualisiert; d.h. es gibt Konflikte zwischen sowjetischen Juden und
Nichtjuden und die Gruppen/ Personen bleiben relativ voneinander getrennt
bzw. verbinden sich nur bei bestimmten Abgrenzungen gegenüber der Majorität.
Insgesamt kann die russischsprachige Umgebung mögliche Konfliktsituationen
in der neuen Umgebung abschwächen und Bezüge zur Herkunftskultur/-region
binden. Dennoch wird auch die "alte" Heimat fremd, ohne daß die Umgebung
hier zur "neuen" Heimat wird.
"Im
Seniorenzentrum ergeben sich Kontakte, sicher. Aber die Menschen haben doch
keine Heimat, sie sind krank in ihrer Seele. Die Bekannten, die Nachbarn,
die Familie fehlt. Und auch wenn sie zurückgehen würden nach Odessa oder
Moskau, das wäre nicht mehr die Stadt, die sie verlassen haben."
(K., Rentnerin, 68)
Von den älteren
Migranten abgesehen, die noch originäre Bindungen zum Judentum haben und
alle "jüdischen" Angebote der Gemeinde wahrnehmen, wird in einem Land, das
den meisten bislang fremd geblieben ist, für viele das Gemeinschaftsgefühl
zunächst Auslöser dafür, sich näher oder wieder für das Judentum zu
interessieren und wird dann oft zum "psychologischen Anker".
"Als ich das
erste mal nach Israel geflogen bin, habe ich mich jede Stunde, jeden
Kilometer, den wir näher gekommen sind, noch stärker, noch besser gefühlt.
Als mich alle so freundlich begrüßt haben, mußte ich weinen. So ein Gefühl
habe ich hier nicht.
In
Berlin gehe ich zum Chanukka-Ball, zum jüdischen Theater, ich war auch in
Bad Kissingen. Es gab ein jüdisches Programm, man hat Leute getroffen aus
anderen Gemeinden, aus Holland, aus Israel, viel interessantes für meine
Seele. Wenn es das alles nicht gäbe, würde ich vielleicht hier nicht leben
wollen."
(K., Rentnerin, 68)
"In der
Jüdischen Schule
[..]
kennt jeder
jeden, kümmert sich um die Probleme des anderen, wie in einer richtigen
Familie.
[..]
Das ist mir wichtig. Die Kinder, die fühlen sich da wohl."
(N.,Laborantin, 30)
"Man lernt die
jüdische Kultur kennen und findet Freunde.
[..]
Ich gehe so oft wie möglich zur Synagoge,
[.. da]
begegne ich
Juden aus aller Welt. Das gefällt mir. Und auch, daß ich dazugehöre."
(A., Schüler, 17)
Insgesamt ist die
"mittlere" Generation jedoch eher mit der Schaffung einer ökonomischen
Existenz befaßt und "überläßt" das Judentum zunächst ihren Kindern, die
weniger Berührungsängste haben und sehr schnell Beziehungen zur jüdischer
Kultur entwickeln. Viele von ihnen besuchen den jüdischen Kindergarten, die
Schulen, Freizeittreffpunkte und Ferienlager und das Augenmerk der
Gemeinde(n) richtet sich vor allem auf sie. Sie sind die eigentlichen
"Kulturvermittler" zu ihren Eltern:
"Ich weiß jetzt
viel mehr über das Judentum, durch meinen Sohn, der lernt das alles in der
Schule.
[..]
Ich finde es schön, die ganzen Sitten und Gebräuche zu benutzen."
(G., Lehrerin, 34)
"Manchmal ist
es mir richtig peinlich, wenn ich meine Kinder fragen muß, worüber sie
eigentlich reden. Sie benutzen jüdische Wörter und erzählen Sachen, die habe
ich noch nie gehört. Langsam beginnt mich das auch zu interessieren."
(N., Laborantin,
30)
Selbst wenn Migranten
wenig "innere" Bezüge zum Judentum haben, ist ihre "äußere" Bindung oft
groß. Den meisten ist es selbstverständlich, daß ihre Kinder Bar bzw. Bat
Mitzwa werden (rituelle Aufnahme in die Gemeinschaft der Erwachsenen) und
sie lassen ihre hier geborenen Söhne auch beschneiden - Dinge, die in der
Sowjetunion nicht mehr üblich oder möglich waren (siehe 3.4). Die Zuwanderer
nehmen die deutschen Juden dabei so wenig mit dem traditionellen
("wirklichen") Judentum verbunden wahr, wie diese sie und orientieren sich
eher an der Art der Religionsausübung ihrer eigenen Großelterngeneration
oder der sephardischen Juden. Ein Journalist:
"Wer bloß auf dem
jüdischen Ticket reist, sammelt die Hilfen der Gemeinde ein, und fort ist
er. Die anderen sieht man, wenigstens an den hohen Feiertagen, in der
Synagoge. Und zwar in der orthodoxen. Auch wenn sie die Gebete [..] nicht
kennen [..] - es bleibt eine mentale Nähe zur Orthodoxie. Der liberale Ritus
ist einfach zu ordentlich, zu deutsch" (Büscher 1995,S.152).
Einige wenige (meist
junge Leute) wenden sich der religiösen Ideenwelt des Judentums zu und
ändern radikal ihre gesamte Lebensweise; überwiegend orientieren sich die
Migranten jedoch an anderen Aspekten und (aus der Religion entstandenen)
Traditionen: Feste, Literatur, Geschichte, Folklore.89
Unabhängig vom
inhaltlichen Bezuges zum Judentum werden durch Zuschreibungsprozesse
(Ethnisierung) von außen ethnische Identifikationen verstärkt bzw. sie
werden bewußt:
"Früher hab ich
nicht so sehr darauf geachtet, was ich bin. Wo ich jetzt hier bin, ist das
anders. Ich bin Jüdin! Das gibt mir Sicherheit. Aber meistens fühle ich mich
immer als Jüdin, wenn jemand Juden angreift."
(I., Zahntechnikerin,
34)
"Erst habe ich
geglaubt, was die Deutschen sagen und was sie zu Hause gesagt haben. Daß wir
schlecht sind und sie ausnutzen und so. Ich habe mich geschämt, Jude zu
sein. Aber jetzt befasse ich mich mit unserer Geschichte. Es ist alles
gelogen. Die sind bloß neidisch auf uns. Sogar ihr Jesus war Jude."
(P., Schüler, 14)
"Die Gemeinde
ist wichtig, weil wir damit stärker sind als andere, die auch nicht Deutsche
sind." (A.,
Schüler, 17)
Den meisten fällt es
schwer, ihr Jude-Sein, abgesehen von einem Gemeinschaftsglauben und der
Definition der Umgebungsgesellschaft mit einem präzisen oder gar mit anderen
Juden übereinstimmenden Inhalt zu füllen. Für die Migranten in der
Bundesrepublik ist zumindest davon auszugehen, daß sie sich (auch selbst)
von "den Deutschen" abgrenzen, auf keinen Fall "Deutsche" werden wollen,
auch wenn sie nicht genau wissen, wie sie sich selbst definieren wollen oder
können (90).
"Manchmal habe
ich Probleme damit zu wissen, wer ich bin. Ich mache mir auch Gedanken, ob
ich Pole, Jude oder Russe bin. Ein Deutscher werde ich nie werden, ich habe
mit Deutschen sehr wenig zu tun, die meisten meiner Freunde sind aus Polen,
Rußland oder Israel."
(A., Schüler, 17[der
Vater ist Pole])
"Ich bin Jude.
Nicht deutscher Jude, nicht Deutscher, nicht Lette. Ich hab zwar jetzt die
deutsche Staatsbürgerschaft, aber das ist bloß wegen dem ständigen
Wohnsitz."
(N., Arzt, 28, seit 1975 in Berlin)
"Ich weiß, daß
ich nie sagen werde: 'Ich bin eine Deutsche'. Judentum ist für mich
Nationalität, nicht Religion. Ich schäme mich deswegen auch nicht."
(G., Lehrerin, 34)
Ohne daß dies bewußt
oder problematisch werden muß, stehen die Migranten genaugenommen fünffach
am Rande von Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft(en) und -kultur(en): In der
Sowjetunion als Juden, die sie nicht mehr "ganz" waren oder sein sollten
bzw. wollten und als (z.B.) Russen, zu denen sie sich selbst nur z.T.
zählten und von denen sie nicht akzeptiert wurden. (Gleichzeitig sind sie
infolge ihrer Migration nicht mehr Teil dieses Gesamtsystems, das dennoch
ihre Heimat war.) Hier gehören sie als Ausländer nicht zur deutschen
Gesellschaft, können sich mit ihr und ihrer Kultur bislang wenig anfreunden,
werden als Juden teilweise wieder von der bestehenden russischen
Gemeinschaft abgelehnt und von einheimischen Juden u.U. als nicht oder "zu
wenig jüdisch" angesehen (91).
Auch wenn die
ungeklärten Gruppenzugehörigkeiten möglicherweise erst nach längerem
Aufenthalt oder in der 2. Generation zu Konflikten führen, bremsen sie den
Eingliederungsprozeß -verbunden mit der Ablehnung durch Teile der Majorität,
mit einem unsicheren Status und mit Problemen, um die es im folgenden geht.
4.2.3 Psychische Probleme und
Neuorientierungen
Die Migranten waren
(sind) sozial und psychologisch mobiler als die Nichtwandernden, fähig ihre
Unzufriedenheit in einen Wanderungsentschluß umzulenken und den Verlust von
"Heimat" für "Fremde" in Kauf zu nehmen. Gleichzeitig stehen sie unter
Erfolgszwang, muß sich die Wanderung lohnen und sind sie mit entsprechenden
Erwartungen nach Deutschland gekommen, ohne dabei ihre zukünftige Situation
realistisch einschätzen zu können. Hier angekommen, sehen sich die meisten
nach anfänglicher Euphorie jedoch (vorerst) weiterhin oder wieder
unbefriedigenden Lebensbedingungen ausgesetzt. Ihre hohen Erwartungen
mobilisieren einerseits die Bereitschaft, sich einzuleben und die neuen
Chancen zu nutzen, andererseits sind sie Ursache für Enttäuschungen und
Probleme, wenn die positiven Vorstellungen nicht mit der hiesigen Realität
übereinstimmen und eigene Umorientierungsnotwendigkeiten und
-schwierigkeiten nicht antizipiert wurden.
Zunächst unabhängig
von konkreten Problemen und Gruppen betrachtet, reagiert ein kleinerer Teil
der Migranten auf Verluste und neue Anforderungen mit (aus der UdSSR
gewohnter) Verantwortungsabschiebung, Entscheidungsunfähigkeit, Verzerrung
von Tatsachen oder Rückzug, wird handlungsunfähig, erlebt Sinnkrisen, die
bis zu einem Zusammenbruch des sozialen Verhaltens oder schweren
Erkrankungen führen. Diese Zuwanderer machen bereits nach relativ kurzem
Aufenthalt (besonders dann, wenn die ersten formalen Schritte erledigt sind)
einen insgesamt depressiven Eindruck. Ohne daß eindeutig feststellbar wäre,
ob Störungen nicht bereits früher bestanden, sind einige
generationsübergreifende Symptome und Auswirkungen häufig beobachtbar
oder werden von Migranten benannt: Apathie, Nervosität, Schlaflosigkeit,
psychosomatische Beschwerden, Eßstörungen, Alkoholismus,
Suchtmittelmißbrauch, Aggressivität, Hyperaktivität.
Die wenigsten reden
über diese Probleme. Häufig wird die Umgebung erst aufmerksam, nachdem
Migranten zwangshospitalisiert worden sind oder im Extremfall Suizid
begangen haben (in Berlin bislang ca. 10 Fälle). Hinzu kommt, daß es an
russischsprachigem Fachpersonal mit entsprechendem kulturspezifischen
Hintergrund fehlt (Kenntnis von Tabuthemen z.B.). Andererseits sind
Psychologen/Psychiater unter den Migranten u.a. durch deren unrühmliche
Rolle in der UdSSR stigmatisiert oder Migranten meinen, nicht krank zu sein
bzw. keine Hilfe zu benötigen.
Nachdem sie vielerlei
Bemühungen unternommen haben, nach Deutschland zu kommen, wollen viele nicht
zugeben, daß sie Probleme haben - aus Angst abgelehnt zu werden oder die
Richtigkeit ihrer Entscheidung, ihres Lebensentwurfes in Frage stellen zu
müssen. Bei einem erheblichen Teil der Zuwanderer werden sie auch durch die
Beschäftigung mit dem Existenzaufbau überdeckt und in einer späteren Phase
durch erhöhten Konsum kompensiert. Migranten setzen "Freiheit" am Anfang
häufig mit dem Wegfall von Versorgungsschwierigkeiten und dem großen
Warenangebot gleich; die Erwartungen an den Konsum bzw. die
Bedürfnisbefriedigung durch ihn hält jedoch nicht lange an. Die eigentlichen
Probleme bleiben letztlich bei vielen in einer resignierten Grundstimmung
und Zurückgezogenheit erhalten, die häufig nicht bewußt ist und durchaus
einer zufriedenstellenden formalen Eingliederung gegenüberstehen kann. Bei
einigen manifestieren sie sich aber auch zu einem Dauerzustand.
Eine als besonders
belastend wahrgenommene Bedingung, die gleich zu Beginn des Aufenthalts zur
Entstehung von Erwartungsenttäuschungen und Konflikten in allen
Altersgruppen beiträgt, betrifft die
Wohnheimunterbringung.
Die Wohnheimsituation markiert für die meisten Migranten auch retrospektiv
den Tiefpunkt ihres neuen Lebens und die Zeit mit dem höchsten
Konfliktpotential. Keine Wohnung zu haben und gleichzeitig arbeitslos zu
sein verdeutlicht in doppelter Weise einen plötzlichen sozialen Abstieg
(z.B. vom Chefarzt mit großer Wohnung im Zentrum Moskaus zum arbeitslosen
Bewohner einer Massenunterkunft am Stadtrand), der nur schwer bewältigt wird
und individuell oder zwischen Ehepartnern zu massiven Problemen führt.
Vermehrt durch die situativen Bedingungen eines Lebens in
Gemeinschaftsunterkünften und in Abhängigkeit von der Wohndauer kommt es
auch bei Kindern und Älteren zu Verhaltensstörungen und Erkrankungen (siehe
4.1.3).
Daneben ist der Umgang
mit der deutschen
Sprache
eines der ersten
und gleichzeitig dauerhaftesten Probleme - das u.a. in Abhängigkeit vom
Einreisealter und der Stellung im Familienzyklus mehr oder weniger bewältigt
wird (siehe 4.1.1). Oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Mangel an
Sprachkompetenzen zu Mißverständnissen, vermehrter Isolation und
verringerten Arbeitsmarktchancen führt. Einerseits beeinflußt der
Spracherwerb die Möglichkeiten in der neuen Umgebung, anderseits sind es
diese Chancen, die ihn beeinflussen. Migranten, die lange im Wohnheim leben,
häufig umziehen müssen, keine Arbeit finden oder Kontakte zu
Deutschsprachigen knüpfen können, vergessen Sprachkenntnisse wieder bzw.
erwerben sie erst gar nicht. Daneben wird der notwendige Spracherwerb
individuell oft als starke Belastung empfunden oder als nicht zu bewältigen:
"Als Dozentin
war ich doch immer ein Mensch der Sprache. Aber mein Sprachzentrum ist
belegt. Ich kann nicht Deutsch lernen. Ich vergesse alles sofort wieder und
bekomme kein Wort heraus."
(L., Medizinerin, 52)
Sprachschwierigkeiten
können auch ab und zu aus dem Versuch resultieren, die eigene
Konfliktunfähigkeit und Gehemmtheit zu rechtfertigen oder zu überdecken oder
werden ins Feld geführt, wenn eine über notwendige sekundäre Kontakte
hinausgehende Beziehung zur deutschsprachigen Umgebung nicht beabsichtigt
ist. Neben der Sprache treffen die Migranten auf eine Unzahl anderer neuer
Bedingungen und Anforderungen, die oftmals konträr zu ihrem bisherigen Leben
und ihren Erfahrungen stehen. Bereits die deutsche Vereinigung hat gezeigt,
wie problematisch schon ein relativ allmähliches und institutionell
abgesichertes "Hineinwachsen" aus der sozialistischen Ständegesellschaft in
die individualisierte "Risikogesellschaft" (Beck 1986) auch für den
Einzelnen sein kann. Die sowjetischen Migranten kommen aus einem
grundsätzlich ähnlichen, rigiden und fremdbestimmenden System mit anderen
Werten, Normen und Kulturtechniken, das Gesellschafts- und
Lebenszusammenhänge, Mentalitäten und Verhaltensweisen geprägt hat. Sie
haben eine ebenso lebenslaufgewohnte/institutionalisierte Sozialisation,
müssen Eigeninitiative oder -verantwortlichkeit in vielen Fällen auch erst
lernen und Erfahrungsregeln und Handlungssicherheiten mehr oder weniger
verwerfen. Bei recht ähnlichen Erwartungen an das neue "System" ist in ihrem
Fall der Kontextwechsel noch komplexer und schwieriger als für die
DDR-Bürger: er ist eher ein "Sprung", erfolgt in ein kulturell entfernteres
und moderneres System, ist mit Ortsveränderungen, einer fremden Sprache und
einem stärkeren "Integrationszwang" verbunden und bedeutet gleich mehrfache
Brüche der Biographie bzw. einschneidende Lebensereignisse: das Erleben der
die Migration auslösenden Probleme und Konflikte wie der Vorgang der
Migration selbst, Entwurzelung, Fremd-Sein, der Verlust sozialer
Beziehungen, die Entwertung des bisherigen Lebenslaufes und der
Lebensleistungen.
Einige Migranten haben
über längere Zeit erhebliche Schwierigkeiten, sich auf die neue Umgebung
einzustellen. Vereinzelt kommt es bei orientalischen Juden zu einer Art
Kulturschock, der u.a. durch völligen Rückzug in die meist vorhandenen
Großfamilien kompensiert wird, von denen einzelne Mitglieder zudem bereits
lange in Berlin leben. Aber selbst europäische Juden -mithin die Mehrheit -
müssen erfahren, daß sie hier fremder sind, als sie erwartet hatten (siehe
2.3), und sich in vielen Bereichen umstellen müssen. Das betrifft die
notwendige Eigeninitiative, aber auch allgemeine Wertvorstellungen und
Vergleichsdimensionen: Konsum, Handlungskontrolle, Zeitregeln, Erziehung,
Konkurrenz, "Freiheit", Recht usw. (siehe auch 4.1.4).
"Ich hab mir
das anders vorgestellt. Die Bürokratie ist noch viel schlimmer als bei uns.
Ich bekomme das ganze Papier gar nicht in die Tasche. Für alles braucht man
Stempel, für alles muß man bezahlen, überall muß man warten."
(A., Dreher, 52)
"In Rußland gab
es von allem zu wenig, hier gibt es von allem zu viel. Wieviel verschiedene
Sorten Brot kann der Mensch essen! Diese Geschäfte, die Angebote, das macht
mich ganz verrückt."
(G.,Rentnerin 76)
"Ich bin ohne
Führerschein und falsch gefahren und sollte ein paar Tausender Strafe
bezahlen. Das wollte ich aber nicht. Ich dachte auch nicht, daß die mich
abholen. Ich meine, im Gefängnis war es wie im Sanatorium, aber trotzdem.
Ich versteh das nicht. 65 Tage Gefängnis ist doch viel teurer als die ganze
Strafe. Und wegen so einer Lappalie. Ich dachte nicht, daß die so kleinlich
sind. [..]
Früher hätte ich das anders geregelt. Aber hier weiß man ja nie, auf wen man
trifft."
(G., Ingenieur, 40)
Die Migranten passen
sich jedoch in unterschiedlicher Weise an die neue Umgebung an und haben
unterschiedliche Probleme bei der Verarbeitung der migrationsbedingten
Umbrüche - je nach Persönlichkeitsdispositionen, individuellen
Lebensschancen und objektiven Generationslagen, sozial-kollektiven oder/und
biographischen Vorgeschichten - den "Hypotheken der Vergangenheit" (Hoernig
1987) -, die Kapital und Hindernis sein können. Obwohl ein Großteil der
Zuwanderer möglicherweise durch seine großstädtische Prägung und (äußere)
Anpassungsfähigkeit keine "sichtbaren" Probleme hat, fallen Kinder und
Jugendliche, "junge Ältere" sowie betagte Migranten als besonders
konfliktbelastet auf.
Aufgrund der
mangelhaften medizinischen Versorgung in der Sowjetunion und des z.T. hohen
Einreisealters (siehe 3.2) weisen viele der
betagten
Einwanderer
bereits bei ihrem
Zuzug einen sehr schlechten Gesundheitszustand auf. Es läßt sich nicht
beurteilen, wie Krankheiten bei den Einzelnen ohne eine Migration verlaufen
wären, es ist jedoch denkbar, daß die migrationsbedingte Dauerbelastung zu
den auffallend häufigen Gesundheitsverschlechterungen und Sterbefällen kurz
nach der Einreise beiträgt (in Berlin ist etwa jeder 9. über 65jährige
Zuwanderer im ersten Jahr nach dem Zuzug verstorben)
(91).
Die Situation der
meisten alten Migranten ist durch Isolation und Immobilität gekennzeichnet.
Die fehlenden Sprachkenntnisse beschränken die Orientierungsmöglichkeiten
und den Aktivitätsrahmen (siehe 4.1.3) maßgeblich, es können weder
intensivere Kontakte zur Bevölkerung hergestellt, noch "passive"
Kommunikationsangebote wie Zeitungen oder Fernsehen ausreichend genutzt
werden (in Seniorenhäuser wird der Einbau von Satellitenantennen häufig
verweigert; in Wohnheimen ist er verboten). Der an sich wünschenswerte
Auszug aus dem Wohnheim in die eigene Wohnung bedeutet für viele Ältere noch
mehr Einsamkeit, u.U. die Trennung von der Familie (siehe 4.1.4) und den
Verlust der Restkontakte zu anderen Bewohnern, die in der selben Lage waren.
Die eigene Wohnung bringt neue Probleme in bezug auf die nötige
Selbständigkeit mit sich: wie macht man einen Mietvertrag, meldet das
Telefon an oder redet mit dem Hauswart, ohne Deutsch zu können.
"Ich war so
glücklich, als ich die Wohnung endlich hatte. Aber jetzt muß ich alles
allein machen. Dauernd hab ich Zores
[Sorgen, Probleme],
weil
ich was falsch verstanden habe und dachte: Ach, wird schon richtig sein.
[..]
Die Kinder
haben ja doch keine Zeit für mich."
(N., Rentnerin, 70)
Ältere Migranten
berichten oft von ihren Irritationen, von - in der hiesigen Gesellschaft
kaum mehr hinterfragten - Alltäglichkeiten, dem Verlust von
Handlungssicherheit, der Entwurzelung aus allen gewohnten Lebensbahnen bis
zur plötzlichen Entwertung gesamter Lebensläufe und Selbstbilder. Sie können
sich kaum noch auf etwas verlassen, was sie in ihrem Leben gelernt und
gehabt haben.
"Ich bin ein
Nichts hier.[..]
Ich
habe doch in einer Riesenstadt gelebt. Ich habe gearbeitet, bis zuletzt.
Alle haben mich geachtet zu Hause und als Ärztin - hab doch gearbeitet, die
Enkel versorgt, gekocht - alles. Und jetzt weiß ich nicht mal, welche Äpfel
am besten schmecken.
[..]
Zu den Leuten
im Haus hab ich keinen Kontakt. Früher haben wir uns immer gegenseitig 'was
geliehen: drei Eier, Zucker.
[..]
Ich bin wie ein
Kind manchmal, ich falle auf alles herein. Als der Mann mir die ganzen
Versicherungen verkauft hat. Er war so nett. Er hat gesagt, daß man sich
versichern muß.
[..]
Jetzt reicht
das Geld nie. Und die Fernsehzeitung brauch ich doch auch nicht. Ich
verstehe ja nichts. Alles ist so kompliziert.
[..]
Ich bin ein
Nichts. Dabei hab ich immer gearbeitet, den Krieg überlebt. Dafür, daß ich
jetzt beim Sozialamt betteln gehen muß. Wer versteht schon, wie ich mich
fühle, wenn sie mich wie einen Parasiten behandeln."
(Ch., Rentnerin, 68)
Zum Sozialamt zu
müssen, wird von vielen nach einem arbeitsreichen Leben als Demütigung
empfunden, verstärkt durch die Unsensibilität und Technokratie mancher
Sachbearbeiter. Die alten Migranten leiden im besonderen Maße unter der
Nichtakzeptanz ihrer Umgebung. Ihr biographisches Selbstgefühl ist stark
durch ihre spezifischen historischen Erfahrungen und die früheren sozialen
Rahmenbedingungen geprägt. Sie haben oft bis zur Ausreise noch gearbeitet
und hatten sowohl familiäre als auch gesellschaftliche Rollen inne. Bis zur
Auflösung der Sowjetunion bzw. bis zur Öffnung zum Westen waren ältere
Menschen hochgeachtet, ihr Rat war gefragt, als Kriegsteilnehmer oder
vorbildliche Arbeiter waren sie geehrt und privilegiert. Sie bringen ihre
Orden und Auszeichnungen mit, stoßen mit ihren Geschichten und dem Stolz auf
ihre (z.T. idealisierte) Vergangenheit jedoch auf Unverständnis. Vielen
bleibt eine negative Lebensbilanz und ein deformiertes Selbstbild. Das
Migrationsziel eines "besseren" Lebensabends wird durch Entfremdung und
Einsamkeit entwertet. Häufig sind sie nur wegen ihrer Kinder ausgereist, um
nicht allein zu bleiben, was sie hier nun u.U. mehr als in der Heimat sind.
"Ich habe 30
Jahre auf Touristendampfern gearbeitet, die Leute unterhalten. Ich kannte
viele Leute. Hier kenne ich niemanden. Bin nur wegen der Enkel hier. Aber
die haben jetzt ihre eigenen Probleme.
[..]
Ich würde es nicht wieder tun. Für den Bauch ist es hier gut, aber nicht für
die Seele."
(V., Rentner, 75)
Die familiären
Bindungen beginnen in der neuen Umgebung stark zu bröckeln, früher scheinbar
reibungslos funktionierende Familienverbände lösen sich auf. Die
Eltern-Kind-Beziehung (hier bei erwachsenen Eltern und Kindern) verändert
sich besonders in Familien, bei denen die "Kinder" noch relativ jung waren,
als sie einreisten. Diese "Kinder" übernehmen die üblichen Einstellungen und
Praktiken der hiesigen Gesellschaft zügig: sie wollen nicht mehr mit den
Eltern zusammenwohnen, übertragen die Verantwortung für sie anderen
Instanzen, haben keine Zeit, treffen Entscheidungen ohne sie und vermitteln
ihnen das Gefühl, auch innerhalb der Familie nicht mehr gebraucht zu werden
und nutzlos zu sein. Zudem sind die Eltern bewahrenden Pflicht- und
Akzeptanzwerten stärker verbunden als die Jüngeren, übernehmen neue
Verhaltensmuster und Normen weniger schnell, geraten zunehmend in Konflikte
mit ihren Kindern oder Enkeln und verlieren auch innerhalb der Familie an
Prestige (siehe 4.1.4).
Bei
Kindern und
Jugendlichen
zeigen sich ebenfalls
Probleme in bezug auf die veränderten Beziehungen zur Eltern- und
Großelterngeneration und auf die Migrationsbewältigung generell. Kinder, die
zum Zeitpunkt der Migration noch nicht im Schulalter waren, scheinen die
Migration relativ unproblematisch zu bewältigen. Sie behalten ihre
Primärbindungen, die i.d.R. noch innerhalb der Familie liegen, durch die
Migration meist aller wichtiger Bezugspersonen weitgehend bei und
unterliegen weniger als ältere Kinder einem Leistungsdruck, der erst durch
den Schulbesuch aktualisiert wird. Für ältere Kinder, die die Migration
bewußt erleben, stellt sich die Situation je nach Alter und bereits
erfahrener Sozialisation im Herkunftskontext oftmals komplizierter dar. Die
Kinder wurden meist erst kurz vor der Ausreise von den Eltern über die
Migrationsabsicht informiert. Sie haben die Ausreiseentscheidung selten
mitgetragen, können sie kaum einordnen und sehen sie eher als Verrat an
(vgl.auch Duwidowitsch 1993). Ihre Enttäuschung ist umso größer, wenn die
Eltern die Versprechungen nicht einhalten können, die sie gemacht haben, um
den Kindern die Migration plausibler und "schmackhafter" zu machen. Unter
dem Verlust von Freunden und gewohnten Orten leidend, werden sie zusätzlich
mit Frustrationen und Krisen ihrer Eltern konfrontiert, die oft ausbrechen,
wenn die eigene Wohnung, die Arbeit, die Erfüllung "aller Träume" auf sich
warten lassen.
Die Familien- und
Lebenssituation spielt generell eine entscheidende Rolle: u.U. bereits vor
der Migration bestehende Spannungen, Ehekonflikte, zeitlich getrennte
Ausreisen von Familienmitgliedern oder das Zusammenleben von mehreren
Generationen in einem Haushalt oder Zimmer tragen zu einem erhöhten
Konfliktpotential bei. Besonders zu Beginn des Aufenthalts, sind Kinder und
Jugendliche zudem häufig sich selbst überlassen - da ihre Eltern
Behördengänge unternehmen und die Kinder meist nicht (wie in der UdSSR) in
eine Kindertagesstätte geben können - oder sie werden von Großeltern
beaufsichtigt (93).
Die Kinder orientieren
sich relativ schnell an (meist ebenfalls russischsprachigen) peer-groups
innerhalb der Schu-le oder des Wohnheims und übernehmen Einstellungen und
insbesondere Konsumorientierungen, die ein Teil der Eltern nicht bedienen
kann (94).
Sie lernen auch
die Sprache am schnellsten, stellen am ehesten Kontakte her und werden zu
Dolmetschern und "Managern" der ganzen Familie (vgl. auch Friedmann 1993,
S.94 für Wien), womit sie meist völlig überfordert sind. Aus den
Beratungsstellen aller Jüdischen Gemeinden wird berichtet, daß es alltäglich
ist, daß Kinder für ihre Eltern oder Großeltern übersetzen -
Angelegenheiten, die sie nicht oder nur teilweise verstehen. Sie tragen
unangemessen hohe Verantwortung, meist ohne daß adäquat auf ihre eigenen
Probleme eingegangen wird. Einerseits erhöht sich durch diese Rolle ihr
Status (auch in der Eigenwahrnehmung) in der Familie, anderseits sollen sie
z.B. in bezug auf elterliche Autorität in der Kind-Rolle verbleiben. Die
Vorstellungen der Eltern werden mit gewohnten Erziehungsmethoden
durchgesetzt und kollidieren zwangsläufig mit den Erfahrungen der Kinder in
ihrem neuen Alltag (vgl. auch IRG 1994, S.13f). Da sie sich zugleich in
einer Phase befinden, in der ihre Identität sich ausbildet (Erikson 1965),
die Kontinuität ihrer Entwicklung bereits durch die Migration einen Bruch
erlitten hat und bisher stützende Werte nun z.T. ungültig werden, verstärken
sich die Autoritätskrisen und Generationskonflikte, die in diesem Alter
ohnehin auftreten. Die Kinder nutzen neue Freiräume schnell, während sich
die Eltern an diese Situation weniger schnell anpassen können oder wollen,
z.T. resignieren oder die Kinder sich selbst überlassen. Befriedigungen im
psychosozialen Bereich und gewohnte Reaktionen der Umwelt bleiben so oft aus
und viele Kinder fühlen sich verloren und verschließen sich. Gleichzeitig
erleidet ihr idealisiertes Elternbild Brüche. Die Eltern sind nicht mehr in
der Lage Orientierungen zu vermitteln und werden von den Kindern als
unselbständig angesehen. Aus gut bürgerlichen Haushalten kommend, mit
Eltern, die Abteilungsleiter oder Ärzte waren, schämen sich die Kinder bald
ihrer dafür, daß sie gebrochen Deutsch sprechen oder keine Arbeit haben und
für ihre Großeltern, die ihre Namen nicht in lateinischen Buchstaben
schreiben können. Die Eltern wiederum projizieren ihre Hoffnungen und
Leistungsansprüche auf ihre Kinder. Sie sollen lernen und studieren, die
neue Konsumgesellschaft (die bereits die Werte auch ihrer Eltern bestimmt)
ignorieren und es einmal "besser haben". Der Auftrag an die Kinder ist es,
erfolgreich zu sein, die Enttäuschungen der Eltern und ihr Versagen zu
kompensieren und somit die Migration letztlich doch noch erfolgreich sein zu
lassen (vgl.auch Tyrangiel 1989). Aber auch die schulische Erziehungs- und
Sozialisationspraxis (Förderunterricht, Nachhilfestunden usw.) läßt den
Kindern kaum Freizeit und -raum.
Während
Aussiedler-Kinder aus Rußland als eher diszipliniert und lernwillig
auffallen, zeigen sich bei den jüdischen Kindern massive Schulprobleme. Wie
Erzieher, Lehrer und Schulpsychologen der Berliner jüdischen Schulen und des
Kindergartens berichten, geben die Kinder ihren Konflikten in verschiedenen
Verhaltensweisen Ausdruck bzw. die Probleme zeigen sich in Auffälligkeiten
wie Leistungsverweigerung, Lernstörungen, Rebellion gegen Eltern oder andere
Sozialisationsinstanzen, Aggressivität oder totaler Rückzug, Konfliktlösung
mit körperlicher Gewalt usw. Eine einheimische Mutter über die
neuzugewanderten Kinder:
"Die sind
aggressiv, gewalttätig und benutzen die furchtbarsten Schimpfwörter. Wenn du
die Eltern hörst, denkst du, sie sind alle Lämmer und Genies. Ich glaube,
viele werden auch vernachlässigt. Die schlagen total über die Stränge, weil
die Lehrer sie schonen und hier nicht diese strenge Erziehung und Disziplin
herrscht. Die Eltern überlassen alles der Schule. Wenn die Kinder Ärger
machen, sind die Lehrer schuld."
Die Eltern
überschätzen die Leistungs- und Umstellungsfähigkeit ihrer Kinder bzw.
suchen Ursachen für Lernprobleme und Verhaltensauffälligkeiten nicht bei
sich oder ihren Kindern (95).
Sie haben
ebenso Probleme, das Bildungs- und Erziehungssystem nachzuvollziehen, das
sich in bezug auf Disziplin, Erziehungsmethoden, Autorität von Lehrern,
Lerninhalten usw. substantiell vom sowjetischen System unterscheidet.
Bei sehr jungen Eltern
(d.h. Personen, die mit einem Kleinkind einreisten oder deren Kinder erst
hier geboren wurden) beginnt sich jedoch zu zeigen, daß die Wanderung im
frühen Familienlebenszyklus offenbar dazu führt, daß hiesige Erziehungs-
bzw. Verhaltenspraktiken eher übernommen werden. Diese Migranten besaßen in
der Sowjetunion noch keine Sozialisation in der Eltern-Rolle, keine
Erfahrungen mit Kindergärten, Schulen oder Erziehung. Je stärker und länger
der Kontakt zur Aufnahmegesellschaft in diesen Fragen ist, um so mehr
Praktiken werden scheinbar übernommen. Dies geschieht durch den Besuch von
Kindergärten und den Kontakt mit einheimischen Eltern, aber bereits in der
Geburtsklinik, wo die Eltern eine Unzahl an Werbematerialien und Tips zur
Pflege, Ernährung, Erziehung, dem Gebrauch von Spielzeug etc. erhalten und
wo Väter, anders als in der UdSSR, bei der Geburt ihrer Kinder anwesend sein
können. Diese Veränderungstendenz fällt auf, soll jedoch keinesfalls
generalisiert werden; dazu ist die Zahl der diesbezüglich beobachteten bzw.
aufgefallenen Eltern zu klein.
Die dritte
Problemgruppe, auf die hier eingegangen werden soll, sind die
"jungen
Älteren",
d.h. hier die etwa zwischen 45 und 60jährigen. Die Migranten waren in der
UdSSR zumindest bis zum offiziellen Rentenalter durchweg erwerbstätig (siehe
3.3). Arbeit galt als hoher Lebenswert und für Juden bestand in ihrem Beruf
oftmals eine der wenigen Möglichkeiten, sich positiv in der sowjetischen
Gesellschaft zu behaupten und gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Hier
angekommen, trägt vor allem die Erfahrung einer Perspektiv- und
Hilflosigkeit durch fehlende befriedigende Arbeitsmöglichkeiten (siehe
4.1.1) zur Manifestierung psychischer und somatischer Probleme bei.
"Ich kann nicht
schlafen, ich habe dauernd Kopfschmerzen. Ich bin niedergeschlagen. Das
hatte ich früher nie. Ich werde verrückt zu Hause. Ich weiß nicht, was ich
da anfangen soll. Ohne Arbeit ist mein ganzes Leben sinnlos. Ich würde alles
machen, ich bin geschickt. Aber niemand nimmt mich."
(A., Goldschmied, 52)
Die "jungen Älteren",
für die Arbeit maßgeblicher Lebensinhalt war, leiden unter der
Arbeitslosigkeit, während sich jüngere Migranten z.T. damit eingerichtet
haben, daß sie nicht unbedingt arbeiten müssen, um zu "überleben".
"Die vor 20
Jahren herkamen, mußten sehr hart kämpfen. Die neuen Zuwanderer haben
wenigstens eine materielle Sicherheit. Aber sie sitzen und warten, bis ihnen
der Schlußstrich gezogen wird und erst dann fangen sie an, etwas zu tun. Sie
verlieren Zeit und merken das nicht."
(G., Lehrerin, 34)
Gleichzeitig haben die
jungen Migranten bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, betrifft sie die
kalendarische Zäsierung in "Arbeitsmarktbrauchbare" und "-unbrauchbare"
nicht (die für die Älteren auch bestimmt, ob sie an Umschulungen und vom
Arbeitsamt geförderten Deutsch-Kurs teilnehmen dürfen) und sie haben eher
Zugang zu Privilegien, Macht, Geld etc. als ihre Eltern-Generation.
"Als
Programmierer hab ich gleich Arbeit gehabt. Erst war ich bei der Universität
und hab dann gewechselt in ein Wirtschaftsunternehmen. Ich sitze da und
schreibe und verdiene an einem Tag soviel, wie ich in Kiew in einem Jahr
verdient habe."
(R., Informatiker, 35)
Für viele "junge
Ältere" bedeutet die Migration bzw. die fehlende Arbeit so u.a. einen
enormen Status- und Prestigeverlust gegenüber jüngeren Kohorten, z.B. den
ebenfalls migrierten Kindern, und im Vergleich zur Herkunftsgesellschaft. In
der Sowjetunion eine anerkannte Autorität gewesen zu sein und hier nicht
geachtet und für unwissend gehalten zu werden und anders als dort über
weniger sozial bedeutsame Werte zu verfügen als jüngere Migranten, führt
daneben zu erheblichen individuellen Dissonanzen, die sich u.a. in den
eingangs erwähnten psychischen Problemen und Verhaltensaufälligkeiten
widerspiegeln (96).
Die Migranten
versuchen, diesen Statusverlust und den fehlenden Zugang zu wichtigen
Bereichen der Gesellschaft bzw. die darausfolgenden Dissonanzen jedoch auf
sehr individuelle Weise zu lösen (97).
Gerade im
Beschäftigungsbereich zeigt sich, bei verschiedenen Altersgruppen, daß die
Migration nicht nur Bedrohung, sondern auch Chance und Herausforderung
darstellt und nicht unter allen Bedingungen und von allen Betroffenen als
Streß (oder "kritisches" Lebensereignis) empfunden wird.
"Ich arbeite in
meinem Beruf, genau wie in Moskau. Vielleicht bin ich auch deshalb
zufrieden, weil ich den Leuten helfen kann."
(G., Lehrerin, 34)
"Die Ausreise
war mein Glück. Ich kann den ganzen Tag
[Klavier]
spielen,
brauche nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit stundenlang anstehen und wenn ich
jetzt nur den zweiten Preis
[bei Wettbewerben]
bekomme, weiß ich, daß ich schlecht gespielt habe und daß es nicht wegen der
Nationalität ist.
[..]
Das ist alles
vorbei. Ich sehne mich nicht zurück, wirklich nicht. Mich interessiert
nicht, was draußen passiert. Ich habe endlich meine Ruhe. Ich spiele besser,
das merke ich doch."
(E., Pianistin, 38)
"Früher war ich
Ärztin. Jetzt ist das Schreiben die Therapie für mich.
[..]
Hier in
Deutschland kann ich nichts veröffentlichen, das kostet viel Geld, allein
die Übersetzungen. Aber ich mache hier Lesungen auf Russisch. Astrid
Lindgren hat mich eingeladen und das Zionistische Forum, nach Israel."
(K.,
Rentnerin, 68)
"Meine Tochter
hat gleich gesagt: 'Mama, ich will nicht mit der gelben Karte
[Fahrkarte für
Sozialhilfeempfänger]
gehen'. Sie hat
hin und her überlegt, was sie machen kann. Jetzt hat sie einen Service für
Pakettransporte in die Ukraine. Viele Leute trauen der Post nicht, da
verschwindet doch die Hälfte."
(G., 76)
"Erst war ich
ja wie lahmgelegt. Es fiel mir schwer, alles selbst zu entscheiden. Hab
immer gewartet, daß jemand kommt und alles regelt. Jetzt finde ich es toll,
viel besser als früher, wo alles vorgeschrieben war. Ich kann studieren, was
ich will, kann meine Seminare festlegen, wie ich will. Ich hab richtig Spaß
daran. Wie ein neues Leben. Ich sage mir immer: 'Junge, jetzt wird was aus
dir'." (O.,
Student, 27)
"Mit meinem
Beruf
[Ingenieur]
kann ich nichts
anfangen. Aber ich komme auch so durch. Ich fahre eben ein bißchen hin und
her, verdiene mal da, mal hier etwas. Man richtet sich eben ein."
(G., Ingenieur,
40)
Andere migrierte
Ethnien dürften die zuvor genannten Umstellungsprobleme vom Prinzip her
ähnlich betreffen. Im Vergleich zu deutschen Aussiedlern, die aus demselben
totalitären "Makrosystem" kommen, sind dennoch einige Spezifika erkennbar.
Es läßt sich vermuten, daß sie zu einem Teil in der unterschiedlichen
Sozialisation und Sozialstruktur beider Gruppen begründet sind. Die Symptome
und Auswirkungen der migrationsbedingten Belastungen und Veränderungen
zeigen sich bei Aussiedlern zunächst ähnlich - Resignation, Gefühle der
Nutzlosigkeit, psychosomatische Beschwerden, erhöhter Alkoholkonsum oder
Aggressivität (vgl. Diakonie-Korrespondenz 10/95) - und sie liegen ebenso
u.a. in Fremdheit, Arbeitslosigkeit und veränderten Konstellationen in der
Sozialhierarchie der Generationen begründet.
Die Differenz zwischen
dem Sozialstatus in der Sowjetunion und in der Bundesrepublik ist bei
Aussiedlern möglicherweise häufig weniger eklatant bzw. wird weniger
gravierend empfunden als bei der Masse der jüdischen Migranten, da die
deutschen Aussiedler in der UdSSR u.a. seltener als diese in leitenden
Positionen und sozial hochgeschätzten Berufen tätig waren (siehe 3.3).
Umgekehrt kann angenommen werden, daß die Abnahme des familieninternen
Status' der älteren Aussiedler bzw. der Eltern vergleichsweise relevanter
ist als bei jüdischen Zuwanderern, da die Familienoberhäupter, Eltern,
Großeltern in der Sowjetunion über ein offenbar proportional höheres
Sozialprestige als in jüdischen Familien verfügten. Die Aussiedler stammen -
wie gesagt - überwiegend aus ländlichen Regionen mit überschaubaren einfach
strukturierten Gemeinwesen und weniger starken Modernisierungseinflüssen und
haben an ihrer "deutschen Identität" bzw. der Vorstellung von ihr stärker
festgehalten als Juden. In der Literatur (u.a. Dietz 1990; Bade 1993; Koller
1993) wird einhellig berichtet, daß bei Aussiedler-Familien strenge Maßstäbe
an Erziehung und Disziplin, väterliche Autorität, Gehorsam und
Rollenaufteilungen zwischen Männern und Frauen angelegt werden, daß
körperliche Züchtigungen gebräuchlich sind und Aussiedler insgesamt durch
traditionell-konservative Wert- und Moralvorstellungen und eine stärkere
Religiosität als einheimische Deutsche auffallen
(98).
Da in ihrem
Fall das "Modernitätsdefizit" zur hiesigen Gesellschaft somit noch größer
sein dürfte als bei jüdischen Migranten, die diese Verhaltens- und
Einstellungsmuster weniger stark aufweisen, sind vermutlich auch die
Konflikte anders gelagert oder stärker als bei diesen: Bei Aussiedlern kommt
es beispielsweise seltener zu Autonomiebestrebungen von Frauen, die sich
auch hier kaum trauen, die Autorität des Mannes anzuzweifeln; bei längerem
Aufenthalt nehmen jedoch Auseinandersetzungen zwischen Kindern und Eltern zu
(vgl. Dietz 1990).
Aus der
unterschiedlichen Sozialisation der beiden Gruppen und dem unterschiedlichen
Verhältnis zu Deutschland mag auch mitresultieren, daß sich ihre
Einstellungen gegenüber hiesigen gesellschaftlichen Strukturen und damit
zusammenhängende Verhaltensweisen unterscheiden. Aussiedler identifizieren
sich eher mit der deutschen Gesellschaft, verleugnen ihre Herkunft
teilweise, wollen sich um jeden Preis anpassen und "gute Staatsbürger"
werden (Dietz 1990); nach einigen Studien zeigen sie dabei jedoch von
Ausschließlichkeit bestimmte Einstellungen (entweder man ist für oder gegen
das System/die Regierung) und neigen dazu, Pluralismus mit Chaos
gleichzusetzen; sie sind stark auf Obrigkeit ausgerichtet, ohne an eigene
Einflußmöglichkeiten zu glauben (Bade/Troen 1993).
Zur jüdischen Gruppe
liegen keine verläßlichen Studien zu Wertvorstellungen, Systemwahrnehmung
etc. vor. Im täglichen Umgang mit Zuwanderern fällt auf, daß sie
"materielle" Inhalte und Aspekte des Aufnahmesystems (wie Aussiedler auch)
schnell übernehmen, an gesellschaftlichen und politischen Strukturen jedoch
mehrheitlich ausgesprochenes Desinteresse zeigen, individualistisch
orientiert sind und nur Gegebenheiten und Gesetze zur Kenntnis nehmen, die
die eigene Person bzw. Gruppe betreffen, ihr nutzen oder schaden könnten
(99).
Zum anderen
entsteht der Eindruck, daß sie (die neue) "Obrigkeit" generell anzweifeln,
bestimmte Rechte und Freiheiten einfordern und praktizieren, die sie für
typisch kapitalistisch halten und sich relativ wenig von
Loyalitätserwägungen gegenüber dem hiesigen System oder seinen Institutionen
leiten lassen; sie zeigen oftmals ein hohes Selbstbewußtsein gegenüber
Autoritäten und verwenden viel Energie darauf, Entscheidungen zu ihren
Gunsten zu beeinflussen oder zu revidieren. Zudem werden Entscheidungen und
die Rechtssprechung meist als (vorteilhaft) uneinheitlich und beeinflußbar
wahrgenommen. Die o.g. Einstellungen und Verhaltensweisen werden durch die
häufig erfolgreichen eigenen oder fremden Interventionsversuche
verschiedener Arten (die sich z.T. an mitgebrachten Techniken aus der
Sowjetunion orientieren), bestärkt (100).
Insgesamt lösen viele
Migranten nach einer Anfangsphase der Euphorie und schnellen
Erwartungsenttäuschung, der oft Lethargie oder Hyperaktivität folgt, ihre
Orientierungskrisen relativ schnell. Sie sind dann in der Lage, die
Ressourcen ihres bisherigen Lebenslaufes (innerhalb des eigenen ethnischen
oder deutschen Umfeldes) auch hier zu nutzen, zeigen sich mobil und
risikofreudig und finden individuelle Problemlösungsstrategien. Dabei
hinterfragen sie etablierte Strukturen meist emotionsneutral und rational
nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip, verwerfen Werte und Normen der hiesigen
Gesellschaft teilweise oder nehmen sie, als für den neuen Lebensentwurf
unnötig oder unpassend, nicht an. Will man die Migranten anhand ihrer
Orientierungsformem und Bewältigungstrategien einteilen, lassen sich
tendenziell zumindest drei Positionen bzw. Gruppen unterscheiden (siehe auch
4.3) (101):
Die erste
Personengruppe hält sich dauerhaft in Deutschland auf, ist aber innerlich
(noch?) nicht angekommen und desintegriert. Sie lebt häufig sowohl vom
russisch- als auch deutschsprachigen Umfeld segregiert, ist
verhaltensunsicher, resigniert und fügt sich in von außen zugewiesene
Positionen. Sie ist u.U. bereit, sich partiell an der Aufnahmekultur zur
orientieren, kann ihre Zugehörigkeits-, Selbstwert- und Kulturkonflikte
jedoch nicht lösen, fühlt sich (oder ist) machtlos und isoliert. Diese
"marginale"
Position läßt sich
relativ unabhängig vom Bildungsniveau vor allem bei Personen mit wenig
Machtmitteln, bei älteren und betagten (oft alleinstehenden) Zuwanderern
beiderlei Geschlechts nachweisen sowie bei orientalischen Juden auch
mittleren Alters.
Die zweite Gruppe
erhält sich beide Bezugskontexte, übernimmt aber nur unabdingbar nötige
Handlungs- und Orientierungsweisen der Aufnahmekultur. Der größere Teil der
Gruppe lebt ständig und ohne Rückkehrabsicht in Deutschland, der kleinere
Teil "pendelt zwischen den Welten" und nutzt die Chancen, die sich in der
alten und in der neuen Umgebung ergeben. Die gesamte Gruppe (bzw. ihre
Mitglieder) zeigt eine Gruppendifferenzierung nach außen, begibt sich in
selbstgewählte "Ghettos" und pflegt Kontakte fast ausschließlich zum
russischsprachigen und u.U. jüdischen Umfeld. Sie segregiert sich bewußt und
gewollt von der einheimischen Bevölkerung/Kultur, versucht die mitgebrachte
Identität und Kultur und die Beziehungen zum Herkunftssystem zu erhalten
sowie Personen, zu denen Bindungen bestehen, nachreisen zu lassen. Diese
Konstellation, eine quasi
"herkunftsorientierte"
Position, findet sich
überwiegend bei Mitgliedern der "Zwischengeneration" (etwa 35 - 55jährige),
sowohl bei europäischen als auch orientalischen Migranten, seltener bei
Migranten aus Berufen mit hohem gesellschaftlichen Prestige und
überdurchschnittlichem Bildungsnivau. Bei Zuwanderern mit diesem
Orientierungsmuster sind Probleme in bezug auf Fremdheitsgefühle, Moral- und
Wertvorstellungen, Statusdegradierung oder Zukunftsangst seltener zu
bemerken.
Die dritte Gruppe
orientiert sich sowohl an der Herkunfts- als auch Aufnahmekultur, akzeptiert
ihre Herkunft bewußt unter teilweiser Aufgabe bisheriger Verhaltensweisen
und Normen und ist offen gegenüber der Majoritätskultur, ohne jedoch alle
Kategorien zu übernehmen, so wie sie es schon in der UdSSR häufig
erfolgreich praktizierte. Bezüge bestehen zur deutschen Majorität und zur
russischen oder jüdischen Gruppe; es wird versucht, Eigenständigkeit zu
bewahren und zugleich der/ den Mehrheit(en) ähnlicher zu werden, vor allem
durch Konsum- und Leistungsorientiertheit und ein partielles "ethnic
revival" in bezug auf das jüdische Umfeld. Diese Charakteristika - eine Art
"duale
Orientierung"
- weisen insbesondere
junge Migranten und Mitglieder der "Zwischengeneration" beiderlei
Geschlechts, eher europäische als orientalische Juden sowie meist Personen
mit höherer Bildung auf. Sie bewältigen trotz emotionaler und kognitiver
Konflikte die Migration weitgehend erfolgreich, stellen positive Ortsbezüge
her und richten sich in und mit ihrer neuen Umgebung ein.
4.3 Zusammenfassende Diskussion
In diesem Kapitel
wurden einzelne Bereiche, Aspekte und Fakten des Lebens der Migranten in
ihrer neuen Umgebung beschrieben, die im folgenden zusammengefaßt und
gleichzeitig hinsichtlich ihrer gegenseitigen Verknüpfung betrachtet werden.
Zunächst zur Situation
der jüdischen Migranten in bezug auf ihre
sozialstrukturelle Position
(102): Von der Stellung im
Arbeits- und
Erwerbssystem
hängt maßgeblich ab,
über welches Einkommen, welchen Status, wieviel Macht eine Person
verfügt, welche Konsum- und Wohnmöglichkeiten ihr offenstehen, d.h.
insgesamt, wie sie bzw. eine Gruppe sich gegenüber der einheimischen
Bevölkerung positionieren kann. Als ein Spezifikum der jüdischen
Migrantengruppe kann zunächst angesehen werden, daß für einen erheblichen
Teil von ihr der Arbeitsmarkt aufgrund des Alters nicht die zentrale Instanz
für die Zuteilung von Ressourcen, Risiken, Chancen und Positionen ist. Dies
gilt in erster Linie für diejenigen, die bei ihrer Einreise über 60 Jahre
alt waren. Für sie werden lediglich die (somit auch begrenzten) ökonomischen
Beziehungen als Konsumenten und nicht als Produzenten Ausgangspunkt der
Verknüpfung mit der neuen Gesellschaft. Hier ist auch der größte Teil jener
Migranten einzubeziehen, die dem Arbeitsmarkt zwar noch zur Verfügung
standen, aber bei ihrer Einreise bereits älter als (etwa) 50 Jahre waren und
die nur in Ausnahmefällen überhaupt eine, wie auch immer geartete, Arbeit
finden; beide Gruppen machen zusammen annähernd 40 % aller Berliner
Migranten aus. Mit dem Umstand, daß die Migration dieser älteren Personen in
erster Linie der Zusammenführung mit Familienmitgliedern diente und eher
sozial als ökonomisch-individuell motiviert war, kann zugleich angenommen
werden, daß bei einem Teil dieser Zuwanderer auch keine
Eingliederungsabsicht in den Arbeitsbereich vorlag.
Aber auch die Mehrheit
der jüngeren, seit 1990 eingereisten, arbeitssuchenden Migranten hat auf dem
deutschen Arbeitsmarkt bislang keine Arbeit gefunden; die beschäftigte
Minderheit übt wiederum ihren Berufen oder ihrer Ausbildung inadäquate
Tätigkeiten aus. Die Zuwanderer gehören aufgrund ihrer Bildungs- und
Berufsprofile selten der Arbeiterschaft an und konkurrieren um andere
Bereiche als z.B. die meist zur Kategorie der Produktionsarbeiter gehörenden
"klassischen Gastarbeiter", jedoch wird auch ihnen der Zugang zu
qualifizierten Bereichen im Aufnahmesystem verwehrt. Zum einen bestehen
restriktive Berufsanerkennungsbedingungen für Akademiker (besonders für
Mediziner, Lehrer) und fehlen zuwanderer- bzw. realitätsbezogene
Umschulungs- und Weiterbildungsangebote; sind sie vorhanden, wird den
Migranten der Zugang sehr viel häufiger als der einheimischen Bevölkerung
verwehrt. Zum anderen wird auch bei adäquaten Voraussetzungen (und ebenso
den früher Eingewanderten) meist nur Zugang in funktional erforderliche und
vom Aufnahmesystem zugelassene oder nachgefragte Bereiche des
Sekundärsektors gewährt: die beschäftigten Migranten verrichten
Hilfsdienste, Zuarbeiten und Anlerntätigkeiten, arbeiten unter ihrer
Qualifikation und unterbezahlt. Einige wenige Spezialisten, hauptsächlich
aus dem naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, konnten
berufsadäquate Arbeitsplätze besetzen.
Im Arbeits- und
Bildungsbereich treten individuelle Faktoren als Ursachen für die geringe
Beschäftigungsquote auf dem deutschen Arbeitsmarkt hinzu: bestimmte nicht
nachgefragte berufliche Spezialisierungen, mangelnde Umstellungsfähigkeiten
und tätigkeitsbezogene Motivationen, überhöhte Ansprüche, das Alter,
Gesundheitsprobleme, unzureichende Deutschkenntnisse usw. Gleichzeitig
stehen eine Diskriminierung und Benachteiligung im Berufs- und
Bildungsbereich und ein fehlender Zugang zu Lern- und Erfahrungsprozessen
einer aktiven Aneignung der Umwelt entgegen, die umgekehrt durch
(antizipierte und reale) Gleichbehandlung wiederum unterstützt und motiviert
wird. Bei Personen mit guten Aufstiegschancen (u.a. formaler
Berufsanerkennung und Akzeptanz) zeigte sich, daß sie sehr viel eher bemüht
sind, Deutsch zu lernen und sich an der Umgebungsgesellschaft zu
orientieren, als diejenigen, die geringe berufliche Eingliederungschancen
haben; dies trifft ebenso häufiger auf die jungen Migranten zu, die ein
Studium oder eine Ausbildung beginnen oder hier abschließen können (Personen
mit entsprechender Vorbildung und Kontingentflüchtlingstatus) als auf
diejenigen, die auf den nichtakademischen Ausbildungssektor angewiesen sind,
in dem sie angesichts des allgemeinen chronischen Mangels an
Ausbildungsplätzen als Ausländer kaum Aufnahmechancen haben.
Die Begrenzung der
Teilhabemöglichkeiten und das u.a. daraus resultierende Hierarchieverhältnis
zwischen den Migranten und der einheimischen Mehrheit sind, verbunden mit
individuellen Voraussetzungen, wiederum Ursache dafür, daß ein Teil der
Zuwanderer selbständige oder auch vom deutschen Arbeitsmarkt bzw. der
Umgebungsgesellschaft relativ unabhängige Erwerbstätigkeiten aufgenommen hat
(die z.T. aber staatlich gefördert werden), eine Art
"ethnische
Ökonomie"
begründet und sich den ungünstigen äußeren Bedingungen zu entziehen
versucht. Seitens der Migranten geschieht dies in Abhängigkeit vom Alter und
der regionalen und sozialen Herkunft der Migranten (Jüngere, Großstädter,
Personen aus nichtwissenschaftlichen Berufszweigen und solche mit
Vorerfahrungen im Handels- und Dienstleistungssektor sind hier am mobilsten
und flexibelsten) und den Motivationen und Zielen der Einzelnen (z.B.
Unabhängigkeit, soziale Sicherheit, schnellstmögliche Anhebung des
Lebensstandards, Erwerb der materiellen Kultur). Wichtige äußere Bedingungen
stellen die Größe der in Deutschland bzw. Berlin lebenden russischsprachigen
Gruppe dar (die Waren/Dienstleistungen nachfragt und billige Arbeitskräfte
bietet und innerhalb derer deutsche Sprachkenntnisse nur bedingt
erforderlich sind), zweitens die regionale Nähe zum Herkunftssystem, die
Reisemöglichkeiten und der Kursunterschied der Währungen (in bezug auf die
Beschaffung von Waren/Dienstleistungen bzw. ihre Absetzung) und drittens
spezifische Interessen bzw. Nachfragen der einheimischen Bevölkerung (z.B.
in Bezug auf russische oder jüdische Gastronomie, Kunst und Kultur). Einige
Zuwanderer können nun ihre eigenen Berufe weiternutzen (z.B. Schuster,
Künstler), andere (z.B. Techniker, Ingenieure, Lehrer) wechseln in
berufsfremde Branchen (z.B. Export-Import, Reinigungsfirmen) oder werden bei
den eigenen, z.T. früher eingereisten Landsleuten (oft unterqualifiziert und
-bezahlt) beschäftigt; dort finden wiederum auch Ältere
Arbeitsmöglichkeiten, die ihnen sonst verschlossen blieben. Diese "ethnische
Ökonomie" darf als weiteres Spezifikum der jüdischen Migrantengruppe gelten,
nicht wegen ihres Vorhandenseins, wohl aber wegen der, gegenüber anderen
ausländischen Ethnien vergleichsweise auffälligen, Schnelligkeit, mit der
sie entstanden ist und sich entwickelt (103).
Ungeachtet dessen lebt
ein erheblicher Teil der Zuwanderer noch von geringfügigen Einkommen oder
staatlichen Transferleistungen. Dennoch haben sich die
materiellen
Lebensverhältnisse
eines Großteils der
Migranten - gegenüber ihrem Leben in der Sowjetunion und dem Zeitpunkt ihrer
Einreise - verbessert, auch wenn sie noch nicht mit denen bundesdeutscher
Bürger vergleichbar sind. Die wichtigsten Konsumwünsche konnten in aller
Regel erfüllt werden (die Übernahme von Konsummustern erfolgt daneben am
schnellsten) und Ungleichgewichte zur einheimischen Bevölkerung werden
teilweise durch die Nutzung von Gütern aus den früheren Ostblockländern,
Discount- und Billigangeboten sowie preiswerten Lebensmitteln kompensiert.
Unabhängig von
individuellen Ungleichbehandlungen und der stärkeren Reglementierung von
Ausländern gelten daneben die Minimalstandards des bundesdeutschen
Sozial- und
Gesundheitssystems
bislang auch für die
Zuwanderer und werden meist in gleicher Weise wie für einheimische
Bevölkerungsteile ähnlicher sozialer Lagen (z.B. Arbeitslose, Behinderte)
angewandt bzw. die Migranten sind durchsetzungsfähig genug, um sie
einzufordern. Ausgenommen sind hier Personen ohne Kontingentfüchtlingsstatus
und diejenigen Älteren, die dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen
bzw. sich dort nicht mehr etablieren können (zusammen ist dies wieder etwa
die Hälfte der Gruppe). Da Letztere als Ausländer keine Rentenansprüche
geltend machen und hier keine Ansprüche mehr erwerben können, sind sie
dauerhaft auf den Bezug von Sozialhilfe angewiesen und - in einigen Fällen
bereits heute, aber spätestens im Zuge der angekündigten Kürzungen von
Leistungen für Minderbemittelte - von Altersarmut betroffen; beides
Faktoren, die auch ihr Selbstgefühl erheblich beeinträchtigen.
In bezug auf die
Wohnraumversorgung/Wohnsituation
- bis auf die
Wohnsitzbindung liegt hier keine formale Benachteiligung gegenüber
Einheimischen vor -, führt die provisorische Unterbringung in Heimen und
überbelegten Wohnungen, je nach Dauer und Anspruchsniveau der Einzelnen
ebenfalls zu Problemen. Inzwischen ist die Wohnsituation für einen Großteil
der (Berliner!) Zuwanderer jedoch zufriedenstellend. Gerade die räumliche
Mobilität und die Wohnpräferenzen, über die uns vergleichsweise viele
Informationen vorlagen, belegen die Bedeutung individueller Bemühungen und
des Vorhandenseins von Beziehungsnetzen, die Erstrangigkeit des eigenen
Wohnraums für das neue Leben und vor allem die Flexibilität und Mobilität
der jüdischen Migranten aller Altersgruppen, denen es auf einem völlig
überlasteten Wohnungsmarkt – z.T. durch mehrfache Umzüge - gelingt, gewohnte
Standards wiederzuerlangen oder zu übertreffen und sich - trotz
Wohnsitzbindungen und rechtlichen Konsequenzen - ungünstigen regionalen
Bedingungen zu entziehen. (Aus dem Mobilitätsverhalten ließe sich auch auf
das Mobilitätspotential
in bezug
auf den Arbeitssektor schließen, der dem Wohnbereich auf der Rangskala
folgt, aber aufgrund zu kurzer Aufenthaltszeiten für einen Teil der
Migranten bislang noch keine Rolle spielt oder noch unwichtiger als ein
Arbeitsplatz ist.)
Auch wenn die
Migranten in der Lage sind, sich den Rechtskonstruktionen, die das
Aufnahmesystem für Ausländer vorsieht, teilweise zu entziehen, bedeutet das
'Migrant-Sein' schwerwiegende Abhängigkeiten und Benachteiligungen gegenüber
der einheimischen Bevölkerung. Der
Ausländer-
und
"Mitbürger"-Status
ist das
Bindeglied für Ausgrenzungen in den meisten Bereichen und deren gesetzliche
und "mentale" Absicherung (104).
Die Migranten
unterliegen ausländerrechtlich begründeten Wohnsitz-, Berufsanerkennungs-
und Arbeitsregelungen, werden als Ausländer/Juden von Teilen der Bevölkerung
diskriminiert/stigmatisiert, sind politisch machtlos, als Nicht-Staatsbürger
(Nicht-Wähler) keine Klientel für die Politik und ihr Aufenthaltsrecht wird
von ihnen selbst als relativ unsicher wahrgenommen, auch wenn es sie - wenn
sie den Flüchtlingsstatus besitzen - anderen ausländischen Gruppen gegenüber
privilegiert, die über kein sicheres Bleiberecht verfügen (die befristeten
Aufenthaltstitel von 1/5 der Berliner Zuwanderer sind jedoch ebenfalls
prinzipiell aufkündbar). Das Fehlen staatsbürgerlicher Rechte und Pflichten,
eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der
Gesellschaft/Arbeitswelt und Ausgrenzung behindern zudem das Entstehen von
Loyalität, Annäherung und Interesse an der (u.a. politischen) Kultur und der
Gesellschaft des Landes bzw. an eigener Beteiligung, seitens der Migranten
wiederum begünstigt durch eine eher individualistische Ideologie, die sich
u.a. aus der Ablehnung der alten sozialistischen Ordnung und einem neuem
Konkurrenzneid ergibt. Selbst wenn sich die Migranten Ressourcenzugänge eher
zu verschaffen wissen als andere Einwanderergruppen und z.T. bereits bessere
Voraussetzungen dafür mitbringen, muß die Integration in das Aufnahmesystem
– bei Unterschieden in Teilbereichen und für einzelne Personen - als
insgesamt gering bis mittelmäßig bzw. als partiell bezeichnet werden, mißt
man sie an der sozialen und beruflichen Situation und der gesellschaftlichen
Stellung/Akzeptanz der Migranten. Dieser Eindruck verstärkt sich, wird die
Ebene der
sozialen
Beziehungen
und die
"kognitiv-soziokulturelle"
Ebene (u.a.
Orientierungsrichtungen, das Maß des Erwerbs von Kenntnissen und
Fähigkeiten) einbezogen: Das Leben der Migranten spielt sich weitgehend
unabhängig von der deutschen Umgebungsgesellschaft ab oder läuft neben ihr
her; Beziehungen beschränken sich größtenteils auf die Familie, den
russischsprachigen Freundes- und Bekanntenkreis und/oder das jüdische
Umfeld; Ehen werden innerhalb der eigenen Gruppe geschlossen. Informelle
Kontakte zu Deutschen sind selten und finden dort statt, wo
Kontakthäufigkeit gegeben ist (Schule, Arbeit), meist ohne zu positiven
Beziehungen zu führen. Die formellen Kontakte werden als unbefriedigend
bezeichnet; die Migranten nehmen bei "den Deutschen" eine "andere"
Mentalität wahr, sind sich sicher, daß sie keine "Deutschen" oder "wie
Deutsche" werden wollen und deren Verhaltensmischung aus "Abwehr und
Umarmung" wird mit Mißtrauen und Irritation begegnet. Eine erhebliche Anzahl
von Zuwanderern verfügt daneben nur über unzulängliche Deutsch-Kenntnisse
und ein äußerst fragmentarisches Wissen über ihre soziale und räumliche
Umgebung sowie die Strukturen der deutschen Gesellschaft; ihre
gesellschaftliche Partizipation reduziert sich auf die Partizipation am
Konsum, in dem Maße, wie die individuelle Situation dies gestattet. Die
Eingliederung bzw. die Annäherung an die hiesige Gesellschaft bleibt ohne
eine breite Interaktionsbasis und informelle Beziehungen partiell; das
Aufnahmesystem und seine Bevölkerung versagen oder erschweren Kontakte,
Orientierungs- und Lernmöglichkeiten (105).
Andererseits
zeigten bereits einige Tendenzen im Arbeits- und Wohnbereich, daß die
Lebensgestaltung der Migranten keinesfalls nur von den Vorgaben und
Angeboten der majoritären Kultur bzw. des Aufnahmesystems, sondern ebenso
von Kontroll- und Einflußmöglichkeiten der Migranten und ihren Motivationen
abhängt. Kausalitäten - z.B. in bezug auf Desegration oder Nichterwerb von
Fähigkeiten und Kenntnissen - sind so auch schwer nachvollziehbar.
Als typisch ist
beispielsweise der Wunsch eines Großteils der Migranten, "unter sich
bleiben" zu wollen, zu bezeichnen. Die gewünschte Segregation geht mit dem
hohen Wert, der auf soziale Beziehungen, Kommunikation und Bindungen
innerhalb der eigenen Familie/Gruppe gelegt wird und mit der Distanzierung
gegenüber Teilen der Gesamtmigrantengruppe einher. Das Sozialverhalten
ähnelt dem in der alten Heimat - Beziehungen werden nach regionaler
Herkunft, politischer Anschauung, Bildung, gesellschaftlicher Position
aufgebaut oder weitergeführt und sind gleichzeitig weniger
"außenorientiert", als in der hiesigen Gesellschaft üblich. Faktoren, die
ein "unter sich bleiben" ermöglichen, sind u.a. der Familienstand (der
überwiegendere Teil ist verheiratet und hat zumindest ein Kind), die hohe
"Verwandtschafts- und Freundeskreisdichte" (infolge der schnellen
Kettenwanderung), die Nähe der Heimat (die Kontakte und Besuchsreisen
ermöglicht) und insbesondere die "ethnic community". Das Berliner Beispiel
dürfte in bezug auf diese Geschlossenheit bislang einzigartig sein
(Parallelen sind in Frankfurt/M. und München beobachtbar). Nur hier
existierte bereits eine miteinander verknüpfte, große "ex-sowjetische" und
"jüdische" Infrastruktur/Gruppe, die sich mit dem Zuzug einiger Tausend
Personen massiv ausgeweitet hat. Davon abgesehen, daß ein Teil der Migranten
auf der institutionellen Ebene des "jüdischen Teils" dieser Gesamtheit
formal ausgeschlossen ist und daß die "ethnische Gemeinde" in bezug auf
kulturelle, religiöse und soziale Hintergründe weder homogen ist noch
zwingend gemeinsame Werte vertritt, ist sie für die Migranten ein
wesentlicher Bezugspunkt des Orientierungssystems und Machtbasis für
Interessenschutz (106).
Aus der Gesamtheit der
Beobachtungen über die "Vierte Welle" läßt sich schlußfolgern, daß diese
"ethnic community" (bzw. deren relative institutionelle und personelle
Vollständigkeit/Größe) mittels ihrer Versorgungs-, Entlastungs- und
Vergleichsfunktion einerseits eine mentale und teilweise soziale Absicherung
sowie die Aufrechterhaltung/Entwicklung ethnischer und subkultureller
Besonderheiten/Präferenzen ermöglicht und Voraussetzung für die
Eingliederung ist, sie aber andererseits gleichzeitig behindert. Ein
erheblicher Teil der Migranten unterhält beinahe alle seine Primärkontakte
und die Mehrzahl der Sekundärkontakte innerhalb dieser Gemeinschaft (dies
ist auch bei vielen Personen und Familien beobachtbar, die seit Beginn der
sowjetischen Einwanderung vor etwa 25 Jahren hier leben). Das Vorhandensein
eigener Netzwerke, Angebotsstrukturen und Beziehungen erlaubt ihnen nicht
nur, Zugang zu bestimmten Bereichen zu erlangen (Arbeit, Wohnen, Freizeit,
Erziehung, Religion), sondern auch innerhalb der ethnischen Beziehungslinie
zu verbleiben und eine Orientierung an der Mehrheitsgesellschaft bzw. den
Vergleich mit ihr und intensivere interethnische Kontakte von sich aus zu
umgehen. Für viele Migranten ist es somit vorläufig ausreichend, gewisse
notwendige Basisorientierungen und -qualifikationen "funktionaler" Art zu
erwerben; die beidseitig schwierige Kontaktaufnahme zur einheimischen
Bevölkerung, das gründliche Erlernen der Sprache, die Übernahme sekundärer
Verhaltensmuster (die Außenorientierung) ist nicht überlebensnotwendig
(107).
Denjenigen, die
mit dem Versuch, in Bereiche des Aufnahmesystems zu gelangen (Arbeit,
Kontakte, Akzeptanz zu finden) gescheitert sind oder die sich aufgrund einer
"Andersartigkeit" massiven externen Typisierungen ausgesetzt sehen, wird der
Rückzug wiederum erleichtert. In einem Fall bedienen, im anderen Fall
kompensieren die sozialen Beziehungen und Einrichtungen innerhalb der
russischsprachigen bzw. jüdischen Ethnie die Motive und Bedürfnisse der
Migranten nach Akzeptanz, Bindungsorten, Heimat/-erinnerung, Sicherheit,
nach Reorganisation ohne Neuanpassung - mit Beziehungen untereinander und
mit russischen (bzw. kaukasischen, moldawischen etc.)
Dienstleistungsunternehmen, Restaurants, Klubs, mit Theatern, Zeitungen,
Radio- und Fernsehprogrammen usw. und mit jüdische Schulen, Seniorenheimen,
Kindergärten, Freizeittreffpunkten, Sozialstationen.
Die
"Binnenintegration" der Migrantengruppe (in bezug auf Eheschließungen,
Geburten, das Ausmaß der Kontakte, "Ähnlichkeit") läßt sich so auch als
relativ hoch, intakt und für den Teil der Migranten als zufriedenstellend
bezeichnen, der unter 4.2.3 als "herkunftsorientiert" bezeichnet wurde und
der nur notwendigste primäre Verhaltensmuster und Regeln pragmatisch
übernimmt und die mitgebrachten versucht, gegenüber der Aufnahmegesellschaft
durchzusetzen. Die da "dual orientiert" genannten Personen beziehen
Vergleich, Entlastung und Versorgung auch aus der ethnischen Gemeinde,
orientieren und messen sich jedoch gleichzeitig an der Aufnahmegesellschaft,
erwerben über grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten hinausgehende
Sprachkompetenzen, arbeitsbezogene Qualifikationen,
gesellschaftlich-kulturelles Wissen und Kulturpraktiken und haben die
häufigsten Kontakte zu Einheimischen.
Die jüdische
Migrantengruppe, die - wie jede Migrantengruppe - durch ungeklärte
Gruppenzugehörigkeiten gekennzeichnet ist, beginnt sich vor allem an der
Stellung im Lebenszyklus (dem Einreisealter) und in Abhängigkeit von
regionaler/sozialer Herkunft, Anspruchsniveaus, vorhandenen Machtmitteln und
ethnischen Bindungen auszudifferenzieren. So gehören der zuletzt genannten
Gruppe - eher als der erstgenannten - jüngere, unabhängige Personen mit
guten beruflichen Ressourcenzugängen und in bestimmten (z.B. Familien)Rollen
noch nicht sozialisierte, aber auch mobile Ältere mit hohem Bildungsniveau
oder kulturell interessierte Migranten an. In dieser Gruppe finden sich z.T.
die Kinder jener Migranten, die oben in einer "marginalen" Position
befindlich beschrieben wurden. Diese sind, bikulturell orientiert, nicht in
der Lage, ihre Orientierungs-, Selbstwert- und Statusverluste und die
veränderten Familienkonstellationen (fehlende Nähe zu Zurückgebliebenen oder
getrenntes Wohnen von den Kindern) zu überwinden und ziehen sich zurück bzw.
werden zurückgestoßen. Die schnellere Übernahme von Praktiken aus der neuen
Umgebung bei den Kindern verändert die familiären Beziehungen und Rollen
dieser meist älteren Migranten, die ohnehin bezüglich der
Altersschichtstruktur im Vergleich zur Herkunftsgesellschaft an Status
verloren haben, was als Spezifikum auch für viele ältere jüdische
Migrantinnen gilt, die in der Sowjetunion ihr Prestige- und Machtpotential
i.d.R. über familieninterne Rollen hinaus auf ökonomischen und
gesellschaftlichen Rollen begründeten.
Die intervenierenden
Bedingungen und Faktoren, die das "neue" Leben der jüdischen Zuwanderer
bestimmen, konnten nicht in ihrer Gesamtheit und für einzelne Personen oder
gar Kohorten aufgezeigt werden und endgültige Aussagen sind nicht zu
treffen. Berücksichtigend, daß die Aufenthaltsdauer selbst der in
Anfangsphase der "Vierten Welle" eingereisten Migranten noch vergleichsweise
kurz ist und die Gesamtgruppe über ein hohes Mobilitätspotential verfügt
sowie relativ individualistisch-, leistungs- und konsumorientiert ist, ist
jedoch die Annahme gerechtfertigt, daß ein Teil - vor allem der
jüngeren
Migranten - eine
realistische Chance hat, Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten zu finden, und je
nach weiteren Partizipationschancen, Sozialisierungsbedingungen und eigenen
Motivationen und Fähigkeiten u.U. in höhere berufliche und soziale
Statusbereiche aufsteigen und zunehmend Maßstäbe der Aufnahmegesellschaft
heranziehen wird. Dies dürfte ebenso für die nachwachsende Generation und
die in der Migration geborenen
Kinder
gelten, deren
Zukunftsaussichten durch den Besuch hiesiger Schulen steigen und denen die
"russisch-jüdische" Umgebung längerfristig nur noch in Teilbereichen und für
Teilorientierungen genügen wird, auch wenn sich deren soziale und
ökonomische Infrastruktur qualitativ und quantitativ ständig erweitert. Für
die große Mehrheit der
älteren
Generation werden
sich die soziale und psychische Situation und die Beziehungen zur
Umgebungsgesellschaft auch perspektivisch kaum noch verändern, da sich weder
ihre eigenen Voraussetzungen noch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen -
in der ihr verbleibenden Lebenszeit - grundsätzlich verändern werden.
Anmerkungen:
(53)
Die verwendeten
Prozentwerte errechnen sich aus den Angaben der Zuwanderer, wie sie im
Fragebogen und der Computerdatei gespeichert wurden. Die Bestätigung bzw.
Aktualisierung der Daten zur Beschäftigung der potentiell betroffenen (17-
65jährigen ) etwa 2.700 Personen war - über eigene Angaben der Zuwanderer
oder Nachfrage - jedoch nur für ca.1.500 Personen möglich. Die
Hochrechnungen auf alle Personen im arbeitsfähigen Alter sind demnach
Schätzungswerte, die Fehlerquoten aufweisen können, dies besonders in bezug
auf die länger in Berlin Lebenden (da von ihnen Veränderungen seltener
gemeldet werden) und auf die nichtmögliche Erfassung von informellen
Erwerbstätigkeiten, als weitere Fehlerquelle bei der Errechnung des Anteils
der Beschäftigten.
(54)
Das sowjetische Bildungssystem ist mit dem deutschen schwer
vergleichbar. Nach dem obligatorischen Grund- (4 Jahre) und
Mittelschulbesuch (4 Jahre) kann mit einer sog. "unvollständigen
Mittelschulbildung" abgeschlossen werden (ähnlich Hauptschulabschluß), die
zum Besuch beruflich-technischer Schulen und mittlerer Fachschulen
berechtigt. Wird die Mittelschule zwei weitere Jahren besucht ("vollständige
Mittelschulbildung"), kann nach einer Aufnahmeprüfung an Technischen
Lehranstalten und Hochschulen studiert werden.
(55)
Bei Personen ohne den
Status eines Kontingentflüchtlings (in Berlin etwa 1/5 aller) werden die
Berufsanerkennungsverfahren noch rigider gehandhabt, womit viele
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und Motivationspotentiale verschlossen
bleiben. Da sie zudem keinen Anspruch auf Deutschkurse, Fortbildung usw.
haben, ist das Finden eines formellen Arbeitsplatzes nahezu unmöglich.
(56)
Die Sprachkenntnisse
bleiben so häufig auf einem niedrigen Niveau oder beschränken sich auf
Begriffe, die in Russisch keine Entsprechung haben oder hier am häufigsten
gebraucht werden: z.B. "Arbeitsamt"; "Schein na kvartiru"
(Wohnberechtigungsschein); "Widerspruch"; "Angebot"; "Sozial" (Sozialamt);
"Gemeinde"; "Vollmacht" usw. Etliche Migranten geben an, keine Gelegenheit
zu haben, Sprachkenntnisse zu vertiefen bzw. sich nicht zu trauen oder zu
schämen, sie anzuwenden. Auch bei Personen, die in den 70er und 80er Jahren
eingereist sind und damals schon nicht mehr jung waren, fällt auf, daß sie
bis heute schlecht oder kaum deutsch sprechen, sich hier also offenbar z.T.
über Jahrzehnte in einer russischsprachigen Umgebung aufgehalten oder
isoliert gelebt haben. Die betagten Migranten lernen daneben kaum noch
deutsch, unabhängig davon, wo sie herkommen oder ob sie Familienangehörige
hier haben. Personen, die jiddisch sprechen bzw. aus früher
deutschsprachigen Teilen des Baltikums stammen, können diesen Vorteil
geltend machen, andere sind völlig von der Hilfe ihrer Umgebung abhängig.
(57)
Unter 5 % der deutschen
Aussiedler beherrschen perfekt deutsch, nur 20 % können sich auf Deutsch gut
verständigen (Hilkes 1990, S.287f).
(58)
R.,Optikerin, seit 1972
in Berlin: "Nach einem Jahr hatte ich zehn paar Schuhe aus dem
Sonderangebot, aber immer noch keine Arbeit. Die Hoffnung, jemals wieder
normal zu leben hatte ich aufgegeben, vielleicht auch verdrängt. Mein Mann
hat mir dauernd gesagt: 'Du wolltest ja unbedingt hierher; wären wir in
Odessa geblieben, hätten wir jetzt wenigstens eine ordentliche Arbeit'.
Irgendwie ist das heute alles nicht mehr wahr. Wir haben beide Arbeit und
die Kinder gehen aufs Gymnasium." S., Kaufmann, seit 1974 in Berlin: "Wir
konnten ja deutsch, nach einer Woche hatte ich schon Arbeit, die hab ich
über eine Zeitungsanzeige gefunden. Meine Frau wurde sogar beamtet. Meine
Söhne sind inzwischen erwachsen, einer ist Zahnarzt, der andere Optiker."
(59)
Die Medien berichten
regelmäßig von der sog. "Russen-Mafia", die jedoch hauptsächlich aus nicht
melderechtlich registrierten Russen, Ukrainern und Tschetschenen besteht
(z.B. Berliner Morgenpost 4.3.95; DER SPIEGEL 35/1995); neben
Schutzgelderpressung, Prostitution, Drogen- und Waffenhandel befaßt sie sich
jedoch auch mit der Vermittlung von Aufenthaltsgenehmigungen für Juden bzw.
"jüdischen Papieren" für Nichtjuden (u.a. Rheinische Post,10.8.94).
(60)
Die Studie verzerrt die
reale Situation, z.B. durch: Interviews an "vorbelasteten" Orten (u.a.
"Handelsplätze in Wäldern in der Nähe russischer Kasernen"); die Art der
Fragestellungen (z.B. "Würden Sie sich gern durch Schwarzarbeit ein
Zusatzeinkommen verdienen?" bzw. "durch den (illegalen) Handel mit der
Sowjetischen Armee?"); falsche Angaben (u.a. Sozialhilfeempfänger könnten
keine Konten eröffnen; eines der "Erkennungsmerkmale" der Migranten sei ihr
"niedriges Durchschnittsalter"); fragwürdige Interpretationen (z.B.
Führerscheinbesitz zeuge "von einer hohen Aktivität der Migranten"), die
sich partiell widersprechen (z.B. sollen die meisten "schwarz"/ illegal gute
Geschäfte machen und "gute Lebensbedingungen" haben, andrerseits fehle ihnen
z.B. das Geld für die Renovierung der Wohnung); Werturteile
("Quasi-Migranten"; "Wunsch sich zu bereichern"; "ohne moralische
Bedenken"). Vor allem durch ständige Generalisierung ("ein derart hoher
Prozentsatz"; "alle", "charakteristisch","generalisierbar") bei gerade 100
Befragten wird der Eindruck erweckt, bei der Gruppe handele es sich
ausnahmslos um jungdynamische Kriminelle, die zwischen russischen Kasernen
und ukrainischem Hausbesitz pendeln. Die Anstrengungen der Verantwortlichen
- so das Fazit - müssten daher auch darauf zielen, die Migranten mit
"deutschen Werten, [...] Fragen der Moral, des Rechts, der Politik, der
Religion und der Erziehung" vertraut zu machen sowie "adäquate
Handlungsvorschläge zum Problem der Illegalen" und "entsprechende
Anweisungen" zu erarbeiten. U.a. könne so aber auch das "intellektuelle und
geschäftliche Potential" der Migranten nutzbar gemacht werden, denn die GUS
biete "Deutschland unbegrenzte Ressourcen billiger Arbeitskräfte,
Absatzmärkte etc."
(61)
Ähnlich der
Asylbewerberquote erfolgt die Verteilung der jüdischen Zuwanderer auf die
Bundesländer prozentual zur Einwohnerzahl nach dem sog. "Königsberger
Schlüssel". Theoretisch müssen die Zuwanderer, die eine Zuteilung für das
Bundesland X erhalten haben, dort auch bleiben; i.d.R. wird dies durch einen
Eintrag im Pass dokumentiert: "Wohnsitznahme im Land X erforderlich". Da
Berlin seine Quote durch den starken Zustrom vor Inkrafttreten des Gesetzes
für die jüdischen Zuwanderer bereits über Jahre erfüllt hat, wird ein Zuzug
nach Berlin nur noch in Ausnahmefällen gestattet - durch Direktzusage des
Landesamtes für Zentrale Soziale Aufgaben oder einen Quotenaustausch mit
einem anderen Bundesland. Diese Zuzüge gelten als "geregelt", alle anderen -
bei anhaltender Sozialhilfeabhängigkeit - als "ungeregelt".
(62)
Die Gruppe erscheint
somit auch nicht in den Statistiken des Landesamtes für Zentrale Soziale
Aufgaben, das lediglich genehmigte Zuzüge registriert (registriert sind hier
auch nicht die Personen, die als Familienzuzüge außerhalb des geregelten
Verfahrens eine Aufenthaltsbefugnis in Anspruch nehmen und lediglich vom
Landeseinwohneramt erfaßt werden).
(63)
Auch die Landesstelle
Unna-Massen veröffentlichte für das Jahr 1995 eine Statistik (701 a), die
den Zuzug aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zeigt. Die
meisten Bundeslandwechsler kamen aus Thüringen und Sachsen, gefolgt von
Bayern, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Daß aus Brandenburg nur
wenige Personen nach Westdeutschland abgewandert waren, liegt u.a. daran,
daß Brandenburger Migranten es vorziehen, in das nahe Berlin zu wechseln.
(64)
Auch bei den deutschen
Aussiedlern konstatiert das Bundesministerium des Inneren besorgt, daß diese
bestrebt seien, das Bundesland (besonders wenn es in der früheren DDR liegt
oder nicht genügend Wohnraum anbieten kann) gegen die
Verteilungsentscheidung zu wechseln und an Orte zu ziehen, wo bereits andere
Aussiedler aus dem gleichen Herkunftsgebiet leben. Ihre Massierung an
bestimmten Orten führe zu Akzeptanzproblemen bei der einheimischen
Bevölkerung - "inbesondere ausgelöst durch das Verhalten jugendlicher
Spätaussiedler bzw. nichtdeutscher Familienangehöriger" - und zur
Überlastung einiger kommunaler Sozialhilfeträger (IDDA, Nr.73/1995,S.9).
Eine z.Zt. diskutierte Gesetzesinitiative soll der Abwanderung beider
Gruppen Einhalt gebieten; für Aussiedler gilt jedoch: "Bei allem müssen wir
aber bedenken: die Spätaussiedler sind Deutsche und haben grundsätzlich
Freizügigkeit" (ebd, S.10).
(65)
Ein Beispiel: Bei
Unabhängigkeit von staatlichen Mitteln (Sozialhilfe etc.), i.d.R. also, wenn
jemand eine Arbeitsstelle in einem anderen Ort gefunden hat, kann die
Wohnsitzbeschränkung gestrichen werden. Neben denen, die tatsächlich wegen
eines Arbeitsplatzes umziehen, gehen einige Migranten fiktive
Arbeitsverhältnisse ein und werden, wenn sie den Umzug geregelt haben,
wieder "gekündigt".
(66)
Hinzu kommt das häufig
hohe Anspruchsniveau der Migranten, das auch im Vergleich mit eigenen
früheren Wohnverhältnissen - in der UdSSR gab es z.B. fast keine
Ofenheizungen - bzw. denen früher Gekommener entwickelt wird.
(67)
Nicht berücksichtigt
sind damit die etwa 500 neuen Gemeindemitglieder, die noch im Wohnheim leben
bzw. als Untermieter noch nie umgezogen sind. Wohnheimwechsel innerhalb
Berlins, d.h. Umzüge von Wohnheim zu Wohnheim, wurden ebenfalls subtrahiert,
da sie i.d.R. nicht auf eigenen Wunsch und selbst herbeigeführt wurden,
sondern aufgrund amtlicher Belegungsänderungen von Wohnheimen. Die
Stichprobe wurde ebenfalls um Datensätze unbekannt verzogener, verstorbener
und aus Berlin abgewanderter Personen bereinigt.
(68)
Die häufigen
aufwendigen Umzüge sind auch ein Beleg gegen die These Freinkmans (1992),
beim größten Teil der jüdischen Migranten handele es sich um
"Scheinmigranten", die aus Verdienstinteressen hierher kämen, um dann sehr
schnell wieder in die GUS zurückzukehren.
(69)
In einem Bericht der
Jüdischen Gemeinde zur Wohnheimsituation wird beschrieben, daß behördlich
angeordnete Heimwechsel üblich sind, die Heime z.T. verkehrsungünstig an der
Peripherie liegen und die Bewohner von der Umwelt isoliert sind. Die
Migranten sind mehr oder weniger sich selbst überlassen, Betreuer kaum
vorhanden bzw. es mangelt ihnen an "mentalen", kulturellen oder sprachlichen
Kompetenzen. Verschiedene Ethnien werden unbedacht in einem Haus
zusammengelegt, die Bewohner haben keine Verfügungsgewalt bzw. Kontrolle
über die eigenen Zimmer. Aufgrund der sozialen und räumlichen Enge ist ihre
Privatsphäre stark eingeschränkt (kaum Aufenthaltsräume, überfüllte
Gemeinschaftsbäder und Küchen), leben Personen verschiedener Generationen in
einem Raum und kann auf Kranke und Behinderte kaum Rücksicht genommen
werden. Diese Bedingungen erzeugen bereits nach kurzer Zeit Frustrationen
und Aggressionen und es kommt zu Streit innerhalb von Familien und zwischen
Heimbewohnern (siehe 4.2.3).
(70)
Verglichen mit den
Angaben des Statistischen Landesamtes Berlin (1994) zur Zahl der
"Staatsbürger der ehemaligen Sowjetunion in Berliner Bezirken" ergeben sich
größere Abweichungen nur für den Osten: In Lichtenberg ist der Anteil
sowjetischer Juden (7 %) proportional deutlich niedriger als der der
Grundgesamtheit "ehemalige Sowjetbürger" (18 %); in den o.g. Neubaubezirken
ist er hingegen auffällig höher (29 zu 17 %). Als Erklärung bietet sich an:
Nach unserer Berechnung leben in Westberlin 78%, in Ostberlin 22 % der
Zuwanderer. Die Grundgesamtheit "ehemaliger Sowjetbürger" beträgt für den
Westen jedoch nur 59 %, für Ostberlin immerhin 41 %, da dort viele Personen
wohnen, die als Angestellte von sowjetischen bzw. DDR-Institutionen,
Studenten, Soldaten, Vertragsarbeiter oder durch Heirat in die DDR gekommen
sind. In Lichtenberg nun lebt ein ausgesprochen hoher Anteil von
Funktionären der ehemaligen Botschaften, des Innen-, Außen- und
Staatssicherheitsministeriums, womit der dortige hohe Anteil auch
sowjetischer Staatsbürger vermutlich erklärbar ist. Der wiederum höhere
Anteil jüdischer Migranten in den Neubaugebieten dürfte sich daraus ergeben,
daß dort Wohnungen leichter zu bekommen sind (nach der Vereinigung sind
viele Bewohner abgewandert), zudem wohnten die Zuwanderer anfangs z.T. in
Heimen in eben diesen Bezirken und beschränkten die Wohnungssuche zunächst
auf die nähere Umgebung (inzwischen wandern aber auch sie wieder ab).
(71)
Von Vorteil ist, daß
sie häufig altengerechte Wohnungen anmieten können. Meist haben sie dann
bessere Wohnverhältnisse als einheimische alte Menschen, die sich oft nicht
entschließen können, aus mängelbehafteten Wohnungen auszuziehen, in denen
sie u.U. jahrzehntelang gelebt haben. Die Desegration von der Familie und
einem altersgemischten Wohnumfeld ist jedoch stark belastend für die alten
Migranten.
(72)
Die Zahl Verheirateter
wird in anderen Untersuchungen (Freinkman 1992, Schoeps 1993) als bedeutend
höher angegeben (zwischen 70 - 85 % ), die Zahl der ledigen, geschiedenen
und verwitweten Migranten dementsprechend niedriger. In der Untersuchung von
Freinkman, die ebenfalls in Berlin durchgeführt wurde, dürfte diese
Differenz an der zu kleinen Stichprobe von 100 Befragten liegen, von denen
z.B. lediglich 9 % über 50 Jahre alt waren (was weder für die Altersstruktur
in Berlin noch im Bundesgebiet zutreffend ist). In der Untersuchung von
Schoeps ist die Stichprobe ebenfalls zu klein, stammt aber aus der gesamten
Bundesrepublik. Somit ist nicht auszuschließen, daß die Berliner einen
Sonderfall darstellen - mit ihrem hohen Anteil an älteren Migranten, mit den
bereits hier lebenden Verwandten (die einen Zuzug Alleinstehender
begünstigen könnten), mit der Großstadtsituation (die unabhängigen Personen
vermeintlich oder tatsächlich mehr Spielraum bietet) und mit dem Umstand,
daß anfangs mehr ungebundene Personen einreisten und es derzeit großer
Flexibilität bedarf, um noch in das "geschlossene" Berlin zu ziehen.
(73)
Zum Vergleich: Aus der
GUS nach Israel wanderten 27 % Singles aus; von den 73 % Familien waren die
Hälfte Ehepaare ohne Kinder, 29 % Familien mit 3 Personen, 15,5 % Familien
mit 4 Personen, 3,5 % Familien mit 5 Personen (Berlin-Umschau, 3/1996, S.6).
Von den (Berliner) deutschen Ausiedlern waren 1995 20 % als Alleinstehende
eingereist, von den 80 % Familien waren 17 % Ehepaare ohne Kinder, 10 %
andere 2-Personen-Familien, 29 % Familien mit 3 Personen, 31 % mit 4
Personen, 9 % mit 5 Personen und 4 % mit 6 - 9 Personen (LASoz VI D ZABL
1/996).
(74)
Bei sonst ähnlichen
Proportionen liegt dabei besonders die Zahl der Zuwanderer-Haushalte mit
einer Person noch weit niedriger und die mit drei Personen weit höher als in
der Berliner Gesamtbevölkerung (vgl. Infratest 1995, S.132).
(75)
Der Berliner "Rekord"
1995 liegt hier bei einer Heirat zwischen einem Zuwanderer des
Geburtsjahrgangs 1914 und seiner neuen Ehefrau, Jahrgang 1919.
(76)
Der
Singularisierungstrend verstärkt sich zusätzlich, da es bei den älteren
Zuwanderern eine auffällige Zahl Todesfälle in einem relativ kurzen Zeitraum
nach der Einreise gibt (siehe 4.2.3). Somit bleibt ein Ehepartner häufig
allein in der Wohnung zurück.
(77)
Sowjetische Aussiedler
legen ähnlich hohen Wert auf Beziehungen zu Verwandten und Freunden, auf
Feste und Feiern aller Art, die anders als bei Juden oft mit deutschen
Traditionen und Zeremonien verknüpft sind (Lieder, Gebete usw.).
(78)
Der Umstand, daß
persönliche Kontakte zu Juden so gut wie keine Rolle als Informationsquelle
über Juden spielten und nur wenige Juden in der BRD leben, veranlaßte
Silbermann et al. bereits in Auswertung zweier Repräsentativumfragen 1974
und 1982 von einem "Antisemitismus ohne Juden" zu sprechen; sie fanden eine
tolerante Gruppe von ca.30 %, eine stark antisemitische Gruppe von ca.20 %
und eine Gruppe von ca. 50 % mit Resten antisemitischer Einstellungen (1982,
S.63). Z.B. stimmte ein erheblicher Teil der Befragten Statements zu wie
"Juden kann man am Aussehen allein erkennen" (45,2 %), sie "arbeiten mit
üblen Tricks" (52,6 %), ihre Fehler sind "Rasse"-bedingt (47,2 %) usw.
(ebd.). Dabei wurde im Sozialisationsprozeß erworbenen "antisemitischen
Einstellungsinhalten in weit stärkerem Maße zugestimmt als Vorurteilen, die
aus heutigen, aktuellen Ereignissen abgeleitet sind" (Sallen 1977,S.72).
(79)
Die aufgesetzte bzw.
inkonsequente Vergangenheits-"Bearbeitung" eines Teils der deutschen
Bevölkerung fördert die Konservierung antisemitischer/ausländerfeindlicher
Einstellungen
und
die Bedienung
philosemitischer Ersatzhandlungen. Letztlich kam mit dem Philosemitismus
eine Veränderung sozialer Werte zum Tragen, doch hat er einiges mit
antisemitischen Vorurteilen gemein. Obwohl sie nicht mit Tradition behaftet
sind, wirken philosemitische Einstellungen/Vorurteile entlastend, schaffen
Distanz von der kollektiven oder individuellen, belasteten Vergangenheit.
Die philosemitische Wahrnehmung/Einstellung ist selektiv wie die
antisemitische: unterschiedslos-stereotyp wird alles Jüdische ins Positive
gewendet, werden Juden distanzlos "veredelt" (von "Jud Süß" zu "Nathan, der
Weise").
(80)
Die meisten bisher
bekannt gewordenen Vorfälle wurden aus den neuen Bundesländern gemeldet,
gefolgt von Berlin, die wenigsten aus den alten Bundesländern. Besonders
gehäuft kamen Übergriffe am Anfang der Einreisewelle 1990/91 in Ostberlin
und peripher gelegenen Wohnheimen auf dem Territorium der ehemaligen DDR
vor.
(81)
Zu ähnlichen
Ergebnissen kam Silbermann bei der Befragung deutscher Juden (1982,S.118).
Den Interviewern fielen dabei Abwehrhaltungen auf ("Ich merke nichts von
Antisemitismus.[..] ich verhalte mich so, daß ich nichts merken kann"; ebd.
S.90) und Unsicherheit über den Begriff Antisemitismus (ein Satz wie "Man
sollte euch alle vergasen!" war für einige nicht ernstzunehmen, für andere
sehr wohl; ebd.S. 84f). Silbermann meint, wie viele Nichtjuden hätten viele
Juden aus der Vergangenheit wenig gelernt, wie damals würden sie Gefahren
nicht zur Kenntnis nehmen (wollen), ihre globalen Vorurteile wären genauso
tradiert und stereotypisiert und beide Konfliktsituationen gleichermaßen
explosiv (ebd.S.128).
(82)
Andererseits gaben 29,2
% an, daß Bekannte den Kontakt abgebrochen hatten, als sie erfuhren, daß
der/die Befragte jüdisch ist; 39,6 % meinten, am Arbeitsplatz oder bei
Behörden als Jude/Jüdin benachteiligt zu werden. 89,6 % der Befragten
empfanden den Rechtsextremismus und die politische Entwicklung in
Deutschland als bedrohlich und nur 12 % hielten die Reaktion staatlicher
Organe auf rechstradikale Ausschreitungen für angemessen (Schopes 1993).
(83)
Aus einem Drohbrief
(erhalten September 1995): "Wir warten noch. Wenn genug von euch da sind,
heizen wir die Öfen wieder an."; aus einem Flugblatt (erhalten Januar 1996):
"Die Gesetze spiegeln den Willen der herrschenden Juden wider. Folge der
Judenherrschaft: immer weniger Deutsche und immer mehr Ausländer.[..] Wir
müssen Widerstand leisten."
(84)
Bundesweit gesehen, ist
das heutige jüdische Leben in der Bundesrepublik und die jüdische
Zuwanderung jedoch selten Gegenstand der Medienberichterstattung, es sei
denn, es geht um die "Prominenz" (Galinski, Bubis, Friedmann usw.) oder den
Nationalsozialismus; ähnliches gilt für die (nichtjüdische)
wissenschaftliche Literatur.
(85)
Ethnische Zugehörigkeit
gehört zur sozialen Identität einer Person. Der Identitätsbegriff orientiert
sich hier am Symbolischen Interaktionismus (Mead 1969, Goffmann 1968 in
Heckmann 1992, S.196ff), nach dem Identität aus Vergesellschaftung durch
Rollenübernahme erfolgt. Aufgrund verschiedener/divergierender
Gruppenmitgliedschaften kommt es zu Spannungen zwischen verschiedenen
sozialen Identitäten einer Person, die durch Akkulturation oder
Dissimilierung gelöst werden (können).
(86)
Hier spielt u.U. die
Negativ-Besetzung aller ihrer Herkunftserfahrungen und die Assoziierung
"Russe"="Kommunist" durch die Einheimischen eine Rolle. Der Zwang, die
Integriertheit in die majoritäre Herkunftsgesellschaft (die individuelle
Nachteile nicht ausschließt) und die Ausbildung der Identität an ihr zu
leugnen, erzeugt Zwiepälte und vergrößert die emotionale Distanz zur eigenen
Vergangenheit.
(87)
Trotz oder wegen dieser
(tautologisch anmutenden) Zugehörigkeitsbestimmung zum Judentum gibt es
anhaltende Kontroversen darüber, wer oder was ein Jude ist. Tabori sieht es
sarkastisch: "Fünfzig Jahre nach Auschwitz versuchen die Rabbiner
herauszufinden, wer ein Jude sei. Jeder weiß die Antwort darauf, nur die
Juden nicht." (Berlin-Umschau 6/94). Eine "juristische" Sicht erweist sich
spätenstens dann als Sackgasse, wenn sie etwas über das eigene
Selbstverständnis von (z.B.säkularisierten) Juden aussagen soll.
Finkielkraut schreibt: "Sind die Juden ein Volk? Eine Religion? Eine Nation?
Alle diese Kategorien sind irgendwie anwendbar, keine befriedigt wirklich.
[..] Es gibt praktisch keine Juden und keine Christen mehr, da fast alle
Zeichen ausgelöscht worden sind, die ihre Unterscheidung erlaubten. Nur hat
sich das Judentum nie im Bereich des Religiösen erschöpft. Auch als
Atheisten, assimiliert und ununterscheidbar von ihren Nachbarn, bestanden
die Juden hartnäckig darauf, jüdisch zu bleiben, selbst wenn sie den Sinn
ihrer Hartnäckigkeit nicht verstanden. Statt gelöst zu sein, hat sich das
Rätsel noch verdichtet" (1984,S.159f).
(88)
Da sich die deutschen
Behörden in einem Fall an der jüdischen, im anderen an der sowjetischen
Definition orientieren, wird einem Teil der nichthalachischen Juden der
Zuzug verweigert. Können sie einreisen, kommt es u.U. wieder zu Problemen,
wenn Behörden auf dem Nachweis der Mitgliedschaft in einer (deutschen)
Jüdischen Gemeinde bestehen, die ohne jüdische Mutter nicht gewährt wird.
(89)
Hier gibt es Parallelen
zu den wenigen Juden, die nach dem Krieg im östlichen Teil Deutschlands
geblieben waren oder dorthin zo-gen, im Glauben ein neues demokratisches
Land aufzubauen (vgl.Wroblewsky 1993, Tora und Trabant). Ein Teil dieser
Juden versucht seit der deutschen Vereinigung durch den Verlust früherer
Ideenwelten entstandene Leerstellen mit der Wiederentdeckung des Judentums
zu füllen, besinnt sich dabei aber meist ebensowenig auf religiöse
Traditionen, sondern auf sozial-utopische oder kulturelle.
(90)
Anders als bei den
sowjetischen Migranten besteht für Teile der hier geborenen bzw. lange hier
lebenden Nachkriegsgeneration das grundsätzliche Problem eines Lebens in
Deutschland. Ihr Judentum definiert sich oftmals über den Genozid, spielt
sich auf einer mehr emotionalen als religiösen Ebene ab und beinhaltet, als
Identifikationsersatz, ein Bekenntnis zu Israel, da sie sich zu Deutschland
nicht bekennen wollen bzw. nicht wissen, ob sie es dürfen, sollen oder
müssen. Dazu trägt die unentschlossene Position der jüdischen Repräsentanten
bei (die sich etabliert haben, aber z.T. weiter von einer "Kofferexistenz"
ausgehen) und der Vorwurf aus Israel, Juden sollten nicht im Land der Täter
leben (1996 vom Staatspräsidenten Weizman vor Mitgliedern der Berliner
Gemeinde erneuert).
(91)
Rußlanddeutsche geraten
in ähnliche Spannungsfelder und Leerstellen zwischen einer russischen und
einer "antiquierten" deutschen Identität (Koller 1993); zudem wurden sie in
der GUS beschimpft: "in letzter Zeit haben uns alle Faschisten genannt"
(Duwidowitch 1994, S.34) und werden hier oft nicht als Deutsche akzeptiert:
"In Karaganda wußten wir immer, daß wir Deutsche sind, hier sind wir Russen"
(ebd.S.33). Anders als Juden, fühlen sie sich jedoch selbst als Deutsche und
betrachten ihre Einreise als Rückkehr in die Heimat.
(92)
Bei einigen Älteren hat
sich der Gesundheitszustand nach der Einreise durch medizinische
Intervention wiederum deutlich verbessert.
(93)
Es gibt auch etliche
Großeltern bzw. -teile, die mit ihren Enkeln allein migriert sind, da deren
Eltern verstorben sind oder Sorgerechte übertragen haben. Diese
Konstellation ist durch das unterschiedliche Anpassungstempo für beide
Seiten besonders problematisch.
(94)
Besonders in den
jüdischen Schulen und den Schulen mit hohem russischsprachigem Schüleranteil
sind die Schichtunterschiede zwischen "neuen" und "alten"
Migrantenkindern/Einheimischen auffallend groß. Die Kinder der etablierten
Eltern verfügen über erhebliche Taschengelder, teure Konsumwaren (Computer,
Kleidung etc.), verbringen ihre Ferien im Ausland, Ältere kommen z.T. mit
PKWs zur Schule usw. An diesen Standards orientieren sich die
Neuzuwandererkinder schnell.
(95)
Dazu trägt bei, daß die
neue Berliner Jüdische Oberschule, die auch etwa 50 % nichtjüdische Kinder
besuchen, Kinder von neuzugewanderten Gemeindemitgliedern (z.T. offenbar aus
Loyalitätserwägungen oder unter dem Druck der Eltern) aufnimmt, die in
anderen Realschulen aufgrund mangelhafter Leistungen das Probehalbjahr nicht
bestanden hätten.
(96)
Bei vielen Akademikern
(i.d.R. Männer) aus gehobeneren Positionen fällt in der Betreuungspraxis
auf, daß sie darauf bestehen, aufgrund ihres ehemaligen Status anderen
gegenüber privilegiert zu sein bzw. zu werden (z.B. als Professor XY vor
anderen eine Wohnung zu bekommen, sich nicht an Sprechzeiten halten oder in
Warteschlangen einreihen zu müssen usw.). Andere dieser arbeitslosen älteren
Migranten tragen ihre ehemaligen Statussymbole in der Öffentlichkeit bei
sich (Aktenkoffer, alte Visitenkarten, Ernennungsurkunden zum "Kandidat der
Wissenschaften").
(97)
Frauen scheinen
allgemein weniger Probleme zu haben, sich auf die neue Situationen
einzustellen, obwohl auch sie einen gesellschaftlichen Statusverlust
hinnehmen müssen. Es sei erinnert, daß sie in der UdSSR ähnlich hohe
Positionen und prestigeträchtige Berufe innehatten wie Männer (3.3), Mütter-
und Berufsrollen gleichermaßen ausübten und hier geringere
Arbeitsmarktchancen haben als Männer, quasi in den häuslichen Bereich (in
ausschließliche Familien-Rollen) zurückgesetzt werden oder weniger
angesehene Arbeiten verrichten. Da sie zu solchen Arbeiten und zu
Umschulungen jedoch eher als Männer bereit sind (4.1.1), steigt wiederum ihr
innerfamiliärer Status ihren Ehemännern gegenüber (der bei ihnen apriori
bereits höher war als bei z.B. Aussiedlerinnen). Die Entwicklung einer
höheren Handlungsautonomie betrifft meist Frauen bis zu einem Alter von etwa
45 Jahren, alleinstehende Frauen und fast ausschließlich im europäischen
Teil der UdSSR aufgewachsene Zuwanderinnen.
(98)
Die Autorin kann die
o.g. herkunftssozialisatorischen Spezifika der Aussiedler (auch in ihrer
Differenz zu jüdischen Migranten) aufgrund eigener zweijähriger Arbeit mit
russisch- und polnischsprachigen Aussiedlern bestätigen, sieht bei sehr
jungen Aussiedlerfamilien jedoch größere Unterschiede zu älteren Jahrgängen
der eigenen Ethnie als zu jüdischen Migranten insgesamt.
(99)
Das betrifft selbst
diejenigen, die in den 70er Jahren als Erwachsene eingereist sind. Die
Antipathie und das Mißtrauen der Migranten gegenüber hiesigen Organisationen
und staatlichen Einrichtungen resultiert auch aus der Abneigung gegen die
sowjetische Bürokratie, gegen ein ideologisiertes Umfeld und aus dem Mangel
an positiven Gemeinschaftserfahrungen. Zudem dürfen sie als Ausländer
(anders als die Aussiedler) nicht wählen und haben noch weniger
Beteiligungschancen bzw. höhere Barrieren dazu zu überwinden.
(100)
Die Zuwanderer selbst
sprechen wenig über die o.g. Fragen oder "illustrieren" sie nebenbei; ein
Beispiel: "Als erstes habe ich gemerkt, daß du hier auch jeden fragen mußt
und alles mögliche versuchen mußt, wenn du was haben willst. Aber beim
Fünften oder Sechsten klappt es garantiert.. [..] Hier wird ja auch nicht
einfach so irgendwas abgelehnt, wie bei uns früher: 'Kriegst Du nicht!
Schluß'. Man bekommt, Gott sei Dank, für alles eine Begründung. Da kann man
ja dagegen widersprechen. Oder man weiß wenigstens, worauf man sich beim
nächsten Mal einstellen muß. [..] Ich gehe immer gleich zum Vorgesetzten,
von den kleinen Angestellten lasse ich mich nicht abwimmeln. Ich bin
hartnäckig. Ich sehe ja auch, wie die anderen [Zuwanderer] ihre Sachen
regeln und was die bekommen. Warum soll ich das nicht versuchen." (I.,
Ingenieurin, 41)
(101)
Die Grenzen zwischen
den Gruppen/Positionen sind z.T. fließend und einige Merkmale treten bei
einzelnen Personen gemischt auf oder treffen u.U. nicht zu. Aufgrund der
insgesamt relativ kurzen und unterschiedlich langen Aufenthaltsdauer der
Migranten und der nur teilweise oder nicht für alle Zuwanderer verfügbaren
Informationen soll der Einteilungsversuch als vorläufige und grobe
Differenzierung verstanden sein (die insofern an Aussagesicherheit gewinnt,
als die Merkmale auf früher migrierte sowjetische Juden ähnlich zutreffen).
(102)
"Sozialstruktur" läßt
sich als Gruppenstruktur verstehen, die die Existenz sozialer Beziehungen
und die Gemeinsamkeit von Merkmalen bezeichnet, z.B. bezogen auf regionale
Herkunft, Konfession, Schichtt und Dimensionen sozialökonomischer
Ungleichheiten (politische, rechtliche, sozialisatorische Aspekte,
Gesundheitsversorgung, Wohnen, schulische Ausbildung und insbesondere die
Stellung im Wirtschafts- bzw. Erwerbsprozeß) - vgl. Heckmann 1992. Für
Gordon (1964, in Esser 1989, S.69) und ähnlich bei Eisenstadt (1954, S.12)
bestimmt das "strukturelle Sein" das ethnischkulturelle Bewußtsein der
Migranten, d.h. das Eindringen in das Status- und Institutionensystem sei
Voraussetzung für jedwede weitere Stufe einer Eingliederung und letztlich
die Aufgabe spezifischer Gruppenidentifikationen.
(103)
Damit beginnt sich die
am Beginn relative sozialstrukturelle Homogenität der Migranten
auszudifferenzieren und trägt (wie schon bei den früher Eingewanderten bzw.
mit ihnen zusammen) zur Entstehung eines ethnischen Kleinbürgertums bei. Ein
Schichtungs/Ungleichheitsverhältnis besteht somit nicht nur gegenüber der
einheimischen Bevölkerung (z.B.unter Selbständigen in der
Gesamtsozialstruktur), sondern entwickelt sich auch innerhalb der jüdischen
Gruppe.
(104)
Hier kommt auch dem
Faktor "Zeit" Bedeutung zu (vgl. Karsten 1986): Die Migranten unterliegen
erzwungenen Untätigkeits- und Wartezeiten (z.B. betreffs Sprachkursen,
Arbeits-, Berufsrechten, Einbürgerung usw., von denen beruflichen
Möglichkeiten abhängen) und bürokratischen Zeitordnungen (Meldefristen in
Sozial- und Ausländerbehörden) und müssen andererseits bestimmte Fähigkeiten
bzw.Kenntnisse erst erwerben (Sprache, Berufsqualifikationen). Beides
impliziert eine verstärkte Durchregelung des Alltags, zeitliche
Mehrbelastung und Kontrollentzug und steht "Erfolgsverpflichtungen" entgegen
(Erwerb von sozialer Sicherheit; Unterstützung Verwandter),die ihrerseits
Zeitdruck erzeugen.
(105)
Dieser Umstand verweist
auf die Fragwürdigkeit politisch-programmatischer Integrationsbegriffe, die
von einer ausschließlichen (dann positiv gedeuteten) Anpassungsleistung der
Migranten an die Aufnahmegesellschaft ausgehen (vgl. Treibel 1990, Hansen
1994), die gleichzeitig durch das machtüberlegene Aufnahmesystem behindert
wird. Da die Kultur/Gesellschaft der Majorität selbst nicht wirklich homogen
ist, bleibt weiter fraglich, welches Bezugssystem eine "völlige"
Integration/Anpassung überhaupt haben kann/soll.
(106)
Aus ihr könnten neue
Formen ethnischer Identität entstehen, die sich aber vermutlich nicht oder
nur partiell auf die "jüdische Seite" beziehen würden, da der längst
assimilationsbereiten, jüdischen Mehrheit mit dem Paßeintrag "Jude" eine
"Identität" zum Zweck der Desintegration aufgezwungen war, die ihnen hier,
nun zum Zweck der Integration, teilweise wieder nur "übergestülpt" wird.
(107)
Hier kann Eisenstadt
gefolgt werden, der davon ausgeht, daß wanderungsauslösende Frustrationen
und Erwartungen an die Zielregion immer nur partiell sind; somit sei auch
die Eingliederung zunächst nur eine partielle (1954, S.4ff). Das betrifft
u.a. bei fast allen die Erwartung eines "besseren und sicheren Lebens" und
damit u.a. den Erwerbsbereich und erklärt z.T. auch die Bemühungen auf dem
"nichtdeutschen" Arbeitsmarkt und die Nicht-Bemühung um Arbeit bei
Älteren/Familiennachzüglern, deren Hauptzziel es war, nah ihrer Verwandten
und in Sicherheit zu leben; die Erwartungen, die oft von falschen Prämissen
und Informationen ausgingen, betrafen wiederum selten die Übernahme von
Kulturmustern/Verhaltensweisen, die so vorläufig unterbleibt; die
Frustrationen bezogen sich ihrerseits vermutlich auch nicht auf die
heimatliche Kultur und Bindung, so daß dieser intakte Bezug hier
reorganisiert wird.
hagalil.com
28-02-03
•
Synagogen
und Gottesdienste
•
Wichtige Adressen
•
Terminkalender
•
Führungen
•
Startseite
•
English Content |